Department Naturschutzforschung
Arbeitsgruppe - Naturschutz-orientierte Populationsökologie - COPE
Der globale Anstieg der Weltbevölkerung und damit verbunden die Ausdehnung menschlicher Aktivitäten führen zunehmend zum Verlust natürlicher Lebensräume, deren Fragmentierung und Verformung. Darüberhinaus werden natürlicher Ressourcen übernutzt und führen zur Instabilität verschiedener Ökosysteme. Schließlich versetzt der Klimawandel jedes Ökosystem zusätzlich unter Stress. Diese anthropogenen Prozesse bedrohen die Biodiversität im Allgemeinen und nicht jede Spezies kommt mit ihnen gut zurecht (Engl: cope); nur durch großen Aufwand und mittels geeigneter Maßnahmen ist der Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten. Für die Anwendung solcher Maßnahmen müssen allerdings viele Faktoren gleichzeitig betrachtet werden, die das Überleben der Arten unter Lebensraumverlust, Übernutzung und Klimaveränderungen beeinflussen. Dazu gehören Umweltfaktoren wie räumliche und zeitliche Stochastizität, räumliche Ausdehnung und die Qualität der verbleibenden Habitate ebenso wie biologische Faktoren, z.B. die Mobilität der Arten, ihre evolutionäres Potential und ihre Populationsparameter. Der Schutz der Arten in sich veränderten Landschaften benötigt daher ein genaues Verständnis der Interaktion all dieser Faktoren.
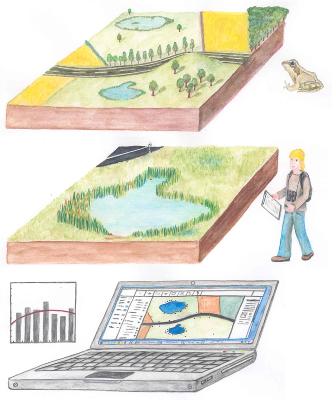
Ein Arbeitsfeld der AG ist die Analyse verschiedener Landnutzungsstrategien und deren Auswirkungen auf die Populationsdynamik bestimmter Tierarten.
Zeichnung: Bianca Bauch
Die Forschungsgruppe COPE versucht, die Auswirkungen verschiedener anthropogener Treiber der Biodiversität auf verschiedenen zeitlichen und räumlichen Skalenebenen (lokal, Landschaft, global) sowie auf verschiedenen Ebenen biologischer Organisation (Art, Population, Gemeinschaft) abzuschätzen. Die von uns untersuchten Haupttreiber sich ändernder natürlicher Konditionen umfassen die Studien invasiver Arten, den internationalen Handel mit Arten, den Klimawandel sowie Habitatverlust aufgrund von Landnutzungsveränderungen. Unser Hauptziel ist daher, die biologischen Prozesse hinter den beobachteten biologischen Mustern zu verstehen, z.B. durch Risikonanalysen (bedrohter) Arten
vor dem Hintergrund einer Übernutzung und Analysen der Ungewissheit von biologischen und ökologischen Daten. Wir konzentieren uns hierbei auf die artspezifischen Eigenschaften und deren Veränderungen, Artausbreitungen, Habitatvernetzungen, Populationsdynamiken, Anpassungsstrategien aber auch die Physiologie und Phylogenie der Arten. Hierbei ist uns der Kontakt zu den betreffenden Akteuren sehr wichtig. So beraten wir auch direkt Behörden und Firmen.
Wir versuchen, Empfehlungen für den Natur- und internationalen Artenschutz zu liefern (z.B. unter welchen Szenarien könnte eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen stattfinden), aber auch Methoden zur Optimierung und Durchführung von Monitoring für lokale, nationale und globale Handlungsträger. Weiterhin versuchen wir lokal auftretende Naturschutzkonflikte, die durch verändertes Vorkommen verschiedener Arten auftreten können, zu verstehen und mittels geeigneter Planunsinstrumente zu minimieren.
Ein wichtiger Teil der COPE-Forschungsgruppe umfasst die Datenerhebung vor Ort, z. B. Bestandsaufnahmen, Erhebungen und Überwachung. Dazu nutzen wir eine Vielzahl an Erfassungsmethoden, darunter auch mittels Citizen Science, Artenspürhunden, ID-tracking und eDNA. Schließlich ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass feldgestützte Biodiversitätsdaten den FAIR-Prinzipien folgen, d. h. auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind, und dass Werkzeuge für die FAIR-Daten- und Metadatenverwaltung bereitgestellt werden.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gäste
Alumni
Alumnis
Alumnis
In unserer AG führen wir auch vierbeinige Mitarbeiter. Nähere Informationen dazu finden Sie hier. Artenspürhunde
Aktuelle Projekte
Biodiversitätsmonitoring - Mitmachen erwünscht!
Unsere AG leitet und beteiligt sich an einer Vielzahl verschiedener Biodiversitätsmonitoringprogramme. Bei einigen davon kann man sich auch als Bürger*in beteiligen. In den meisten Projekten muss man eine Art Schulung belegen um teilnehmen zu können. Einige davon sind aber auch für jeden zugänglich. Hier gibt es eine Übersicht:
Nachstehend folgen Projekte, die formell als abgeschlossen gelten. In einigen Fällen werden jedoch inhaltliche Fragestellungen auch unabhängig von finanziellen Förderungen und administrativen Rahmenbedingungen weiterverfolgt. Das können Aktivitäten zur Veröffentlichung von weiteren Ergebnissen, Feldarbeiten zur Erhebung weiterer Daten oder auch Aktivitäten zur Beantragung neuer Projekte sein. Oft haben sich in den abgeschlossenen Projekten neue interessante Fragestellungen herauskristalisiert oder es gibt Fragestellungen, die in dem Rahmen angerissen, aber nicht abschließend bearbeitet werden konnten. Das sind gute Ausgangspunkte für Bachelor und Masterarbeiten oder vielleicht auch ein PhD-Projekt. Studenten sowie interessierte Mitarbeiter dürfen gern bei den betreffenden Projektleitern nachfragen und werden nach Möglichkeit eingebunden und unterstützt.
Inhalt:
- 2026 (3)
- 2025 (27)
- 2024 (26)
- 2023 (16)
- 2022 (23)
- 2021 (21)
- 2020 (23)
- 2019 (18)
- 2018 (20)
- 2017 (23)
- 2016 (11)
- 2015 (15)
Weiterführende Recherchen können Sie in unserem Publikationsverzeichnis durchführen.
2026 (3)
- Dufresnes, C., Gippner, S., Hofmann, S., Litvinchuk, S., Žagar, A., Jablonski, D., Pottier, G., Megía-Palma, R., Sánchez-Montes, G., Jiménez Robles, O., Ayllón, E., Crochet, P.-A., Martínez-Solano, I. (2026):
Slippery slopes: Montane isolation and elevational shifts shape the evolution and diversity of Iberolacerta lizards
Mol. Phylogenet. Evol. 216 , art. 108502 10.1016/j.ympev.2025.108502 - Hofmann, S., Rödder, D., Schmidt, J., Flecks, M., Jablonski, D., Dubois, A., Ohler, A., Baniya, C.B., Vershinin, V., Litvinchuk, S.N., Dufresnes, C. (2026):
Diversification and historical biogeography of the Himalayan toad (Duttaphrynus himalayanus)
Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol. 683 , art. 113473 10.1016/j.palaeo.2025.113473 - van Swaay, C., Schmucki, R., Roy, D., Dennis, E., Collins, S., Fox, R., Kolev, Z.D., G. Sevilleja, C., Warren, M.S., Whitfield, A., Wynhoff, I., Arnberg, H.J.H., Balalaikins, M., Barea, J.M., Boe, A.M.B., Bonelli, S., Botham, M.S., Bourn, N.A.D., Cancela, J.P., Caritg, R., Dapporto, L., Ducry, A., Dušej, G., De Flores, M., Dopagne, C., Escobés, R., Eskildsen, A.E., Zdenek, F.F., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Glogovčan, P., Gohli, J., Gracianteparaluceta, A., Grill, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Hoye, T.T., Judge, M., Kati, V., Krenn, H.W., Kühn, E., Kuussaari, M., Lang, A., Lehner, D., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Melero, Y., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Montes, A., Munguira, M.L., Musche, M., Olivares, F.J., Ozden, O., Pladevall, C., Pavličko, A., Pettersson, L.B., Rakosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Scalercio, S., Schönwälder, M., Settele, J., Sielezniew, I., Sielezniew, M., Sobczyk-Moran, G., Stefanescu, C., Švitra, G., Svabadfalvi, A., Tiitsaar, A., Titeux, N., Tzirkalli, E., Tzortzakaki, O., Ubach, A., Vičiuvienė, E., Vray, S., Zografou, K. (2026):
EU Grassland Butterfly Index 1991-2024 Technical report
Zenodo
35 pp. 10.5281/zenodo.18414228
2025 (27)
- Bolte, L., Ertmer, J., Preißler, K., Klute, L., Schaffer, S., Barth, M.B., Steinfartz, S. (2025):
Unaddressed hybridization between green (Bufotes viridis) and natterjack toads (Epidalea calamita) can lead to underestimation of genetic heterozygosity and inflated estimates of inbreeding
Amphib. Reptil. 46 (1), 127 - 139 10.1163/15685381-bja10212 - Bolte, L., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2025):
Unreclaimed mines are key habitats for pioneer specialists: A case study on natterjack toad (Epidalea calamita) microhabitat occupancy
Glob. Ecol. Conserv. 64 , e03942 10.1016/j.gecco.2025.e03942 - Bolte, L., Weiß, H., Henle, K. (2025):
Übersäuerte Laichgewässer: Eine ökologische Falle für Amphibien in der Bergbaufolgelandschaft
Natursch. Landschaftspl. 57 (03), 22 - 29 10.1399/NuL.108585 - Colom, P., Tejeda, A., Bonelli, S., Fontaine, B., Kuussaari, M., Maes, D., Mestdagh, X., Munguira, M.L., Musche, M., Pettersson, L.B., Roy, D., Rüdisser, J., Šašić, M., Schmucki, R., Stefanescu, C., Titeux, N., Settele, J., van Swaay, C., Gordillo, J., Melero, Y. (2025):
The interplay of climate change, urbanization, and species traits shapes European butterfly population trends
bioRxiv 10.1101/2025.02.13.638066 - Durka, W., Michalski, S.G., Höfner, J., Bucharova, A., Kolář, F., Müller, C.M., Oberprieler, C., Šemberová, K., Bauer, M., Bernt, M., Bleeker, W., Brändel, S., Bucher, S.F., Eibes, P.M., Ewald, M., Goldberg, R., Grant, K., Haider, S., Harpke, A., Haun, F., Kaufmann, R., Korell, L., Kunzmann, D., Lauterbach, D., Leib, S., Lenzewski, N., Loritz, H., Madaj, A.-M., Mainz, A.K., Meinecke, P., Mertens, H., Meyer, H.M., Musche, M., Ristow, M., Rosche, C., Roscher, C., Rutte, D., Schacherer, A., Schmidt, W., Schmoldt, J., Schneider, S., Schwarz, J.-H., Skowronek, S., Socher, S.A., Stanik, N., Twerski, A., Weiß, K., Weiß, M., Wille, A., Zehm, A., Zidorn, C., the RegioDiv Consortium, (2025):
Assessment of genetic diversity among seed transfer zones for multiple grassland plant species across Germany
Basic Appl. Ecol. 84 , 50 - 60 10.1016/j.baae.2024.11.004 - Greenwell, M.P., Botham, M.S., Bruford, M.W., Day, J.C., Gibbs, M., Høye, T.T., Maes, D., Middlebrook, I., Musche, M., Pettersson, L.B., Roy, D.B., Settele, J., Stefanescu, C., Teder, T., Thomas, N.E., Watts, K., Oliver, T.H. (2025):
Monitoring spatiotemporal patterns in the genetic diversity of a European butterfly species
Insect. Conserv. Divers. 18 (1), 80 - 94 10.1111/icad.12786 - Harpke, A., Kühn, E., Schmitt, T., Settele, J., Musche, M. (2025):
The Grassland Butterfly Index for Germany
Nat. Conserv.-Bulgaria (59), 315 - 334 10.3897/natureconservation.59.162812 - Henle, K., Klenke, R., Barth, B., Grimm-Seyfarth, A., Bowler, D.E. (2025):
Challenges and opportunities for assessing trends of amphibians with heterogeneous data – a call for better metadata reporting
Nat. Conserv.-Bulgaria (58), 31 - 60 10.3897/natureconservation.58.137848 - Henle, K., York, S., Gruber, B., Grimm-Seyfarth, A. (2025):
Auswirkungen von Klima wan del und extremer Hochwasser auf eine aride Reptiliengemein schaft im Kinchega-Nationalpark, Australien
Elaphe 2025 (4), 54 - 57 - Kasiske, T., Klimek, S., Dauber, J., Harpke, A., Kühn, E., Levers, C., Schwieder, M., Settele, J., Sietz, D., Tetteh, G.O., Musche, M. (2025):
Identifying typical patterns of land-use and landscape structure in citizen science butterfly monitoring
Ecol. Indic. 180 , art. 114317 10.1016/j.ecolind.2025.114317 - Klein, A.-M., Thompson, A., Lakner, S., Mupepele, A.-C., Paetow, H., Sponagel, C., Bieling, C., Bleidorn, C., Breitkreuz, L., Hasenöhrl, U., Sommer, M., Tanneberger, F., Bruelheide, H., Muus, K., Schmidt, A., Settele, J., Sporbert, M., Kühn, I., Buscot, F., Otto, P., Böhning-Gaese, K., Fornoff, F., Ssymank, A., Musche, M., Harpke, A., Bartkowski, B., Eisenhauer, N., Ristok, C., Tebbe, C.C., von Hagenow, C.S., Schoof, N., Schreiner, V., Mehring, M., Morhart, C. (2025):
Agriculture and open land
In: Wirth, C., Bruelheide, H., Farwig, N., Marx, J., Settele, J. (eds.)
Faktencheck Artenvielfalt. Assessment of the status of biodiversity and prospects for conservation in Germany
oekom, München, p. 217 - 355 10.14512/9783987264733 - Koch, V.P., Bolte, L., Harms, W., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2025):
Wildlife detection dogs effectively survey a terrestrial amphibian, but differ among individuals, weather and habitat
Ecol. Solut. Evid. 6 (2), e70062 10.1002/2688-8319.70062 - Koch, V.P., Bolte, L., Harms, W., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2025):
Data from: Wildlife detection dogs effectively survey a terrestrial amphibian, but differ among individuals, weather and habitat
Dryad 10.5061/dryad.hqbzkh1vg - Kühn, E. (2025):
Buchvorstellung „Geheimnisvolle Schmetterlingswelt“
Oedippus 42 , 62 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Settele, J. (2025):
Editorial
Oedippus 42 , 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Settele, J. (2025):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Auswertung 2005–2023
Oedippus 42 , 6 - 43 - Lanuza, J.B., Knight, T.M., Montes-Perez, N., Glenny, W., Acuña, P., Albrecht, M., Artamendi, M., Badenhausser, I., Bennett, J.M., Biella, P., Bommarco, R., Cappellari, A., Castro, S., Clough, Y., Colom, P., Costa, J., Cyrille, N., de Manincor, N., Dominguez-Lapido, P., Dominik, C., Dupont, Y.L, Feldmann, R., Felten, E., Ferrero, V., Fiordaliso, W., Fisogni, A., FitzPatrick, Ú., Galloni, M., Gaspar, H., Gazzea, E., Goia, I., Gómez-Martínez, C., González-Estévez, M.A., González-Varo, J.P., Grass, I., Hadrava, J., Hautekèete, N., Hederström, V., Heleno, R., Hervias-Parejo, S., Heuschele, J.M., Hoiss, B., Holzschuh, A., Hopfenmüller, S., Iriondo, J.M., Jauker, B., Jauker, F., Jersáková, J., Kallnik, K., Karise, R., Kleijn, D., Klotz, S., Krausl, T., Kühn, E., Lara-Romero, C., Larkin, M., Laurent, E., Lázaro, A., Librán-Embid, F., Liu, Y., Lopes, S., López-Núñez, F., Loureiro, J., Magrach, A., Mänd, M., Marini, L., Beltran Mas, R., Massol, F., Maurer, C., Michez, D., Molina, F.P., Morente-López, J., Mullen, S., Nakas, G., Neuenkamp, L., Nowak, A., O'Connor, C.J., O'Rourke, A., Öckinger, E., Olesen, J.M., Opedal, Ø.H., Petanidou, T., Piquot, Y., Potts, S.G., Power, E.F., Proesmans, W., Rakosy, D., Reverté, S., Roberts, S.P.M., Rundlöf, M., Russo, L., Schatz, B., Scheper, J., Schweiger, O., Serra, P.E., Siopa, C., Smith, H.G., Stanley, D., Ştefan, V., Steffan-Dewenter, I., Stout, J.C., Sutter, L., Motivans Švara, E., Świerszcz, S., Thompson, A., Traveset, A., Trefflich, A., Tropek, R., Tscharntke, T., Vanbergen, A.J., Vilà, M., Vujić, A., White, C., Wickens, J.B., Wickens, V.B., Winsa, M., Zoller, L., Bartomeus, I. (2025):
EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks
Glob. Ecol. Biogeogr. 34 (2), e70000 10.1111/geb.70000 - Lanuza, J.B., Knight, T.M., Montes-Perez, N., Glenny, W., Acuña, P., Albrecht, M., Artamendi, M., Badenhausser, I., Bennett, J.M., Biella, P., Bommarco, R., Cappellari, A., Castro, S., Clough, Y., Colom, P., Costa, J., Cyrille, N., de Manincor, N., Dominguez-Lapido, P., Dominik, C., Dupont, Y.L, Feldmann, R., Felten, E., Ferrero, V., Fiordaliso, W., Fisogni, A., FitzPatrick, Ú., Galloni, M., Gaspar, H., Gazzea, E., Goia, I., Gómez-Martínez, C., González-Estévez, M.A., González-Varo, J.P., Grass, I., Hadrava, J., Hautekèete, N., Hederström, V., Heleno, R., Hervias-Parejo, S., Heuschele, J.M., Hoiss, B., Holzschuh, A., Hopfenmüller, S., Iriondo, J.M., Jauker, B., Jauker, F., Jersáková, J., Kallnik, K., Karise, R., Kleijn, D., Klotz, S., Krausl, T., Kühn, E., Lara-Romero, C., Larkin, M., Laurent, E., Lázaro, A., Librán-Embid, F., Liu, Y., Lopes, S., López-Núñez, F., Loureiro, J., Magrach, A., Mänd, M., Marini, L., Beltran Mas, R., Massol, F., Maurer, C., Michez, D., Molina, F.P., Morente-López, J., Mullen, S., Nakas, G., Neuenkamp, L., Nowak, A., O'Connor, C.J., O'Rourke, A., Öckinger, E., Olesen, J.M., Opedal, Ø.H., Petanidou, T., Piquot, Y., Potts, S.G., Power, E.F., Proesmans, W., Rakosy, D., Reverté, S., Roberts, S.P.M., Rundlöf, M., Russo, L., Schatz, B., Scheper, J., Schweiger, O., Serra, P.E., Siopa, C., Smith, H.G., Stanley, D., Ştefan, V., Steffan-Dewenter, I., Stout, J.C., Sutter, L., Motivans Švara, E., Świerszcz, S., Thompson, A., Traveset, A., Trefflich, A., Tropek, R., Tscharntke, T., Vanbergen, A.J., Vilà, M., Vujić, A., White, C., Wickens, J.B., Wickens, V.B., Winsa, M., Zoller, L., Bartomeus, I. (2025):
Correction to EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks
Glob. Ecol. Biogeogr. 34 (3), e70014 10.1111/geb.70000 - Lausch, A., Selsam, P., Heege, T., von Trentini, F., Almeroth, A., Borg, E., Klenke, R., Bumberger, J. (2025):
Monitoring and modelling landscape structure, land use intensity and landscape change as drivers of water quality using remote sensing
Sci. Total Environ. 960 , art. 178347 10.1016/j.scitotenv.2024.178347 - Lauterbach, M., Adam, J., Bolte, L., Paule, S., Reinhardt, T. (2025):
On the occurrence of a golden colour variant in the Common Spadefoot Toad, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), in the state of Saxony, Germany
Herpetology Notes 18 , 941 - 946 - Maia-Braga, P.L., Bueno, A.S., Davies, R.G., Maximiano, M.F.A., Haugaasen, T., Anciães, M., Blake, J.G., Loiselle, B.A., Borges, S.H., Menger, J., Dantas, S., Melinski, R.D., de Abreu, F.H.T., Boss, R.L., Peres, C.A. (2025):
How much sampling is enough? Four decades of understorey bird mist-netting across Amazonia define the minimum effort to uncover species assemblage structure
Ibis 10.1111/ibi.70015 - Musche, M., Albrecht, M., Becker, J., Bittermann, J., von Blanckenhagen, B., Böck, O., Caspari, A., Caspari, S., Dolek, M., Harpke, A., Hermann, G., Joger, H.G., Kolligs, D., Lange, A., Müller, D., Nunner, A., Pollrich, S., Reinelt, T., Rennwald, E., Schmitz, O., Schönborn, C., Schulze, W., Schurian, K., Strätling, R., Wachlin, V., Wiemers, M. (2025):
Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Papilionoidea et Zygaenidae) Deutschlands
170
94 S. 10.19217/rl17011 - Rojas-Troncoso, N., Gómez-Silva, V., Grimm-Seyfarth, A., Schüttler, E. (2025):
Dog–stranger interactions can facilitate canine incursion into wilderness: The role of food provisioning and sociability
Biology-Basel 14 (8), art. 1006 10.3390/biology14081006 - São Pedro, M., Smith, M.N., Zuquim, G., Tuomisto, H., Stark, S.C., do Amaral Pereira, L.G., Bobrowiec, P.E.D., Bueno, A.S., Capaverde Jr., U., Castilho, C., Esteban, E., Lima, A., Magnusson, W., Menger, J., Goretti Pinto, M., Rincón, L., da Cunha Tavares, V., Waldez, F., Schietti, J. (2025):
Forest structure predicts plant and animal species diversity and composition changes in an Amazonian forest
Biodivers. Conserv. 34 , 3865 - 3888 10.1007/s10531-025-03136-4 - Settele, J., Aracil, A., Arnberg, H., Åström, S., Bacon, J., Frenzel, M., Grescho, V., Harpke, A., Honchar, H., Kühn, E., Menger, J.S., Musche, M., Nogueira Tavares, C., Schmidt, V., Schweiger, O., Sevilleja, C.G., et al. (2025):
SPRING - Strengthening Pollinator Recovery through Indicators and monitoring. Final Report 2024
European Commission, Brussels, 116 pp. 10.2779/7978371 - Settele, J., Steiner, R., Reinhardt, R., Feldmann, R., Hermann, G., Musche, M., Kühn, E., Brehm, G. (2025):
Schmetterlinge. Die Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Ulmer, Stuttgart, 288 S. - van Swaay, C., Schmucki, R., Roy, D., Dennis, E., Collins, S., Fox, R., Kolev, Z.D., G. Sevilleja, C., Warren, M.S., Whitfield, A., Wynhoff, I., Arnberg, H.J.H., Balalaikins, M., Barea, J.M., Boe, A.M.B., Bonelli, S., Botham, M.S., Bourn, N.A.D., Cancela, J.P., Caritg, R., Dapporto, L., Ducry, A., Dušej, G., De Flores, M., Dopagne, C., Escobés, R., Eskildsen, A.E., Zdenek, F.F., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Glogovčan, P., Gohli, J., Gracianteparaluceta, A., Grill, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Hoye, T.T., Judge, M., Kati, V., Krenn, H.W., Kühn, E., Kuussaari, M., Lang, A., Lehner, D., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Melero, Y., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Montes, A., Munguira, M.L., Musche, M., Olivares, F.J., Ozden, O., Pladevall, C., Pavličko, A., Pettersson, L.B., Rakosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Scalercio, S., Schönwälder, M., Settele, J., Sielezniew, I., Sielezniew, M., Sobczyk-Moran, G., Stefanescu, C., Švitra, G., Svabadfalvi, A., Tiitsaar, A., Titeux, N., Tzirkalli, E., Tzortzakaki, O., Ubach, A., Vičiuvienė, E., Vray, S., Zografou, K. (2025):
EU Grassland Butterfly Index 1991-2023 Technical report
Zenodo
10.5281/zenodo.16367397
2024 (26)
- Barth, B., Bolte, L., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Seyring, M. (2024):
Empfehlungen zur Ermittlung von Bestandstrends der Pionieramphibien Kreuzkröte (Epidalea calamita) und Wechselkröte (Bufotes viridis) in hochdynamischen Tagebaulandschaften [Recommendations for surveys on population trends of the pioneer species natterjack toad (Epidalea calamita) and the green toad (Bufotes viridis) in very dynamic large-scale mining landscapes]
In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)
Neue Methoden der Feldherpetologie
Mertensiella 32
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 134 - 147 - Chiacchio, M., Rödder, D., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2024):
Data from: Influences of ski-runs, meadow management and climate on the occupancy of reptiles and amphibians in a high-altitude environment of Italy
Dryad 10.5061/dryad.0gb5mkm6v - Chiacchio, M., Rödder, D., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2024):
Influences of ski-runs, meadow management and climate on the occupancy of reptiles and amphibians in a high-altitude environment of Italy
Ecol. Evol. 14 (5), e11378 10.1002/ece3.11378 - de Melo Martins, G., Menger, J., de Melo, T.N., Ribas, C.C. (2024):
Impacts of large dams on Amazonian floodplain bird communities
Biotropica 56 (4), e13351 10.1111/btp.13351 - Dubiner, S., Aguilar, R., Anderson, R.O., Arenas Moreno, D.M., Avila, L.J., Boada-Viteri, E., Castillo, M., Chapple, D.G., Chukwuka, C.O., Cree, A., Cruz, F.B., Colli, G.R., Das, I., Delaugerre, M.-J., Du, W.-G., Dyugmedzhiev, A., Doan, T.M., Escudero, P., Farquhar, J., Gainsbury, A.M., Gray, B.S., Grimm-Seyfarth, A., Hare, K.M., Henle, K., Ibargüengoytía, N., Itescu, Y., Jamison, S., Jimenez-Robles, O., Labra, A., Laspiur, A., Liang, T., Ludgate, J.L., Luiselli, L., Martín, J., Matthews, G., Medina, M., Méndez-de-la-Cruz, F.R., Miles, D.B., Mills, N.E., Miranda-Calle, A.B., Monks, J.M., Morando, M., Moreno Azocar, D.L., Murali, G., Pafilis, P., Pérez-Cembranos, A., Pérez-Mellado, V., Peters, R., Pizzatto, L., Pincheira-Donoso, D., Plummer, M.V., Schwarz, R., Shermeister, B., Shine, R., Theisinger, O., Theisinger, W., Tolley, K.A., Torres-Carvajal, O., Valdecantos, S., Van Damme, R., Vitt, L.J., Wapstra, E., While, G.M., Levin, E., Meiri, S. (2024):
A global analysis of field body temperatures of active squamates in relation to climate and behaviour
Glob. Ecol. Biogeogr. 33 (4), e13808 10.1111/geb.13808 - Dubiner, S., Anderson, R.O., Aguilar, R., Arenas Moreno, D.M., Avila, L.J., Boada-Viteri, E., Castillo, M., Chapple, D.G., Chukwuka, C.O., Cree, A., Cruz, F.B., Colli, G.R., Das, I., Delaugerre, M.-J., Du, W.-G., Dyugmedzhiev, A., Doan, T.M., Escudero, P., Farquhar, J., Gainsbury, A.M., Gray, B.S., Grimm-Seyfarth, A., Hare, K.M., Henle, K., Ibargüengoytía, N., Itescu, Y., Jamison, S., Jimenez-Robles, O., Labra, A., Laspiur, A., Liang, T., Ludgate, J.L., Luiselli, L., Martín, J., Matthews, G., Medina, M., Méndez-de-la-Cruz, F.R., Miles, D.B., Mills, N.E., Miranda-Calle, A.B., Monks, J.M., Morando, M., Moreno Azocar, D.L., Murali, G., Pafilis, P., Pérez-Cembranos, A., Pérez-Mellado, V., Peters, R., Pizzatto, L., Pincheira-Donoso, D., Plummer, M.V., Schwarz, R., Shermeister, B., Shine, R., Theisinger, O., Theisinger, W., Tolley, K.A., Torres-Carvajal, O., Valdecantos, S., Van Damme, R., Vitt, L.J., Wapstra, E., While, G.M., Levin, E., Meiri, S. (2024):
A global analysis of field body temperatures of active squamates in relation to climate and behaviour [Dataset]
Dryad 10.5061/dryad.5dv41nscz - Durka, W., Michalski, S.G., Höfner, J., Harpke, A., Korell, L., Madaj, A.-M., Musche, M., Roscher, C., RegioDiv-Konsortium, (2024):
RegioDiv — Genetische Vielfalt krautiger Pflanzenarten in Deutschland und Empfehlungen für die Regiosaatgut-Praxis
BfN-Schriften 687
Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, 315 S. 10.19217/skr687 - Durka, W., Michalski, S.G., Höfner, J., Kolár, F., Müller, C.M., Oberprieler, C., Semberová, K., Harpke, A., Korell, L., Madaj, A.-M., Musche, M., Roscher, C., RegioDiv-Konsortium, (2024):
Projekt RegioDiv - genetische Vielfalt krautiger Pflanzen in Deutschland: Ergebnisse und Empfehlungen für die Regiosaatgut-Praxis [RegioDiv project - Genetic diversity of herbaceous plants in Germany: Results and recommendations for seed zone management]
Nat. Landsch. 99 (7), 322 - 332 10.19217/NuL2024-07-02 - Franklin Guimaraes, A., Carramaschi de Alagao Querido, L., Rocha, T., de Jesus Rodrigues, D., Viana, P.L., de Godoy Bergallo, H., Fernandes, G.W., Menger, J., Ferrer, J., et al. (2024):
Disentangling the veil line for Brazilian biodiversity: An overview from two long-term research programs reveals huge gaps in ecological data reporting
Sci. Total Environ. 950 , art. 174880 10.1016/j.scitotenv.2024.174880 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W. (2024):
Evaluierung von herpetofaunistischen Spürhunden für Monitoring und Naturschutz [Evaluation of detection dogs for herpetofauna in monitoring and conservation]
In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)
Neue Methoden der Feldherpetologie
Mertensiella 32
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 66 - 79 - Harpke, A., Brünecke, J., Bohring, H., Grescho, V., Haase, K., Kühn, E., Kuhnert, T., Musche, M., Petruschke, S., Schnicke, T., Sielaff, D., Strätling, J., Bumberger, J. (2024):
BioMe - The butterfly monitoring Germany usecase
Version: 0.1 Zenodo 10.5281/zenodo.11190783 - Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg., 2024):
Neue Methoden der Feldherpetologie
Mertensiella 32
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, 272 S. - Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (2024):
Vorwort
In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)
Neue Methoden der Feldherpetologie
Mertensiella 32
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 4 - 5 - Hofmann, S., Jablonski, D., Schmidt, J. (2024):
Morphological and molecular data warrant the description of a new species of the genus Scutiger (Anura, Megophryidae) from the Central Himalaya
ZooKeys (1210), 229 - 246 10.3897/zookeys.1210.127106 - Jablonski, D., Hofmann, S. (2024):
Over-splitting and inconsistently applied criteria: a response to recent changes on the taxonomy of mountain spiny frogs (Dicroglossidae, Nanorana)
Alytes 41 (1-4), 40 - 48 - Jablonski, D., Mebert, K., Masroor, R., Simonov, E., Kukushkin, O., Abduraupov, T., Hofmann, S. (2024):
The Silk roads: phylogeography of Central Asian dice snakes (Serpentes: Natricidae) shaped by rivers in deserts and mountain valleys
Curr. Zool. 70 (2), 150 - 162 10.1093/cz/zoad008 - Kasiske, T., Dauber, J., Dieker, P., Harpke, A., Klimek, S., Kühn, E., Levers, C., Schwieder, M., Settele, J., Musche, M. (2024):
Assessing landscape-level effects of permanent grassland management and landscape configuration on open-land butterflies based on national monitoring data
Biodivers. Conserv. 33 (8-9), 2381 - 2404 10.1007/s10531-024-02861-6 - Klein, A.-M., Thompson, A., Lakner, S., Mupepele, A.-C., Paetow, H., Sponagel, C., Bieling, C., Bleidorn, C., Breitkreuz, L., Hasenöhrl, U., Sommer, M., Tanneberger, F., Bruelheide, H., Muus, K., Schmidt, A., Settele, J., Sporbert, M., Kühn, I., Buscot, F., Otto, P., Böhning-Gaese, K., Fornoff, F., Ssymank, A., Musche, M., Harpke, A., Bartkowski, B., Eisenhauer, N., Ristok, C., Tebbe, C.C., von Hagenow, C.S., Schoof, N., Schreiner, V., Mehring, M., Morhart, C. (2024):
Agrar- und Offenland
In: Wirth, C., Bruelheide, H., Farwig, N., Marx, J., Settele, J. (Hrsg.)
Faktencheck Artenvielfalt. Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland
oekom, München, S. 217 - 355 10.14512/9783987263361 - Kühn, E., Harpke, A., Schmitt, T., Settele, J., Kühn, I. (2024):
Counting butterflies - are old-fashioned ways of recording data obsolete?
J. Insect Conserv. 28 , 577 - 588 10.1007/s10841-024-00577-0 - Liu, Y., Dunker, S., Durka, W., Dominik, C., Heuschele, J.M., Honchar, H., Hoffmann, P., Musche, M., Paxton, R.J., Settele, J., Schweiger, O. (2024):
Eco-evolutionary processes shaping floral nectar sugar composition
Sci. Rep. 14 , art. 13856 10.1038/s41598-024-64755-5 - Menger, J., Magagna, B., Henle, K., Harpke, A., Frenzel, M., Rick, J., Wiltshire, K., Grimm-Seyfarth, A. (2024):
FAIR-EuMon: a FAIR-enabling resource for biodiversity monitoring schemes
Biodiver. Data J. 12 , e125132 10.3897/BDJ.12.e125132 - Menger, J., Santorelli Junior, S., Emilio, T., Magnusson, W.E., Anciães, M. (2024):
Palms predict the distributions of birds in the southwestern Amazonia and are potential surrogates for land-use planning by citizen scientists
Biodivers. Conserv. 33 , 2911 - 2924 10.1007/s10531-024-02895-w - Rodrigues-Filho, C.A.S., Costa, F.R.C., Schietti, J., Nogueira, A., Leitão, R.P., Menger, J., Borba, G., Souza Gerolamo, C., Avilla, S.S., Emilio, T., Volkmer de Castilho, C., Bastos, D.A., Rocha, E.X., Fernandes, I.O., Cornelius, C., Zuanon, J., Souza, J.L.P., Utta, A.C.S., Baccaro, F.B. (2024):
Multi-taxa responses to climate change in the Amazon forest
Glob. Change Biol. 30 (11), e17598 10.1111/gcb.17598 - Rodrigues-Filho, C.A.S., Costa, F.R.C., Schietti, J., Nogueira, A., Leitão, R.P., Menger, J., Borba, G., Souza Gerolamo, C., Avilla, S.S., Emilio, T., Volkmer de Castilho, C., Bastos, D.A., Rocha, E.X., Fernandes, I.O., Cornelius, C., Zuanon, J., Souza, J.L.P., Utta, A.C.S., Baccaro, F.B. (2024):
Multi-taxa responses to climate change in the Amazon forest
figshare 10.6084/m9.figshare.25021103 - Seyring, M., Barth, B., Bolte, L., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A., Günther, A., Bertram, S., Kasperidus, H., Langbehn, T., Lueg, H., Henle, K. (2024):
Empfehlungen zur Etablierung von Standardmethoden zur Ermittlung von Bestandstrends bei Amphibien als Modellgruppe
für Biodiversitätsverlust [Establishing standardized methods for analysing abundance trends of amphibians as a
model group to assess the loss of biodiversity]
In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)
Neue Methoden der Feldherpetologie
Mertensiella 32
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 90 - 113 - Slabbert, E.L., Knight, T.M., Wubet, T., Frenzel, M., Singavarapu, B., Schweiger, O. (2024):
Climate and land use primarily drive the diversity of multi-taxonomic communities in agroecosystems
Basic Appl. Ecol. 79 , 65 - 73 10.1016/j.baae.2024.06.003
2023 (16)
- Bolte, L. (2023):
Supplementary Material 7 including Salamandra salamandra occurrence data, topographic, geological and land cover data and node-based resistances [Data set]
Zenodo 10.5281/zenodo.7759814 - Bolte, L., Goudarzi, F., Klenke, R., Steinfartz, S., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K. (2023):
Habitat connectivity supports the local abundance of fire salamanders (Salamandra salamandra) but also the spread of Batrachochytrium salamandrivorans
Landsc. Ecol. 38 (6), 1537 - 1554 10.1007/s10980-023-01636-8 - Chiacchio, M., Pellitteri-Rosa, D., Barbi, A., Corlatti, L., Rödder, D., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2023):
Comparative success of two sampling techniques for high-altitude Alpine grassland reptiles under different temporal designs
Amphib. Reptil. 44 (4), 431 - 440 10.1163/15685381-bja10150 - Dornelas, M., Chow, C., Patchett, R., Breeze, T., Brotons, L., Beja, P., Carvalho, L., Jandt, U., Junker, J., Kissling, W.D., Kühn, I., Lumbierres, M., Lyche Solheim, A., Mjelde, M., Moreira, F., Musche, M., Pereira, H., Sandin, L., Van Grunsven, R. (2023):
Deliverable 4.2 Novel technologies for biodiversity monitoring - Final Report
ARPHA Preprints 10.3897/arphapreprints.e105600 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W., Mazoschek, L., Scholz, M. (2023):
Landhabitate von Kamm- und Teichmolchen und deren Einfluss auf individuelle und Populationsparameter
Jahresschrift für Feldherpetologie und Ichthyofaunistik in Sachsen 24 , 50 - 81 - Hochkirch, A., Bilz, M., Ferreira, C.C., Danielczak, A., Allen, D., Nieto, A., Rondinini, C., Harding, K., Hilton-Taylor, C., Pollock, C.M., Seddon, M., Vié, J.-C., Alexander, K.N.A., Beech, E., Biscoito, M., Braud, Y., Burfield, I.J., Buzzetti, F.M., Cálix, M., Carpenter, K.E., Chao, N.L., Chobanov, D., Christenhusz, M.J.M., Collette, B.B., Comeros-Raynal, M.T., Cox, N., Craig, M., Cuttelod, A., Darwall, W.R.T., Dodelin, B., Dulvy, N.K., Englefield, E., Fay, M.F., Fettes, N., Freyhof, J., García, S., García Criado, M., Harvey, M., et. al. (2023):
A multi-taxon analysis of European Red Lists reveals major threats to biodiversity
PLOS One 18 (11), e0293083 10.1371/journal.pone.0293083 - Hofmann, S., Masroor, R., Jablonski, D. (2023):
First comprehensive tadpole description of the relict and endemic mountain frog Chrysopaa sternosignata (Murray 1885) from Afghanistan
Herpetologica 79 (3), 128 - 134 10.1655/Herpetologica-D-22-00046 - Hofmann, S., Schmidt, J., Masroor, R., Borkin, L.J., Litvintchuk, S., Rödder, D., Vershinin, V., Jablonski, D. (2023):
Endemic lineages of spiny frogs demonstrate the biogeographic importance and conservational needs of the Hindu Kush–Himalaya region [Dataset]
Global Biodiversity Information Facility 10.15468/7uahnz - Hofmann, S., Schmidt, J., Masroor, R., Borkin, L.J., Litvintchuk, S., Rödder, D., Vershinin, V., Jablonski, D. (2023):
Endemic lineages of spiny frogs demonstrate the biogeographic importance and conservational needs of the Hindu Kush–Himalaya region
Zool. J. Linn. Soc. 198 (1), 310 - 325 10.1093/zoolinnean/zlac113 - Junker, J., Beja, P., Brotons, L., Fernandez, M., Fernández, N., Kissling, W.D., Lumbierres, M., Lyche Solheim, A., Maes, J., Morán-Ordóñez, A., Moreira, F., Musche, M., Santana, J., Valdez, J., Pereira, H. (2023):
D4.1. List and specifications of EBVs and EESVs for a European wide biodiversity observation network
ARPHA Preprints 10.3897/arphapreprints.e102530 - Kahnt, B., Theodorou, P., Grimm-Seyfarth, A., Onstein, R.E. (2023):
When lizards shift to a more plant-based lifestyle: The macroevolution of mutualistic lizard-plant-interactions (Squamata: Sauria/Lacertilia)
Mol. Phylogenet. Evol. 186 , art. 107839 10.1016/j.ympev.2023.107839 - Kasiske, T., Dauber, J., Harpke, A., Klimek, S., Kühn, E., Settele, J., Musche, M. (2023):
Livestock density affects species richness and community composition of butterflies: A nationwide study
Ecol. Indic. 146 , art. 109866 10.1016/j.ecolind.2023.109866 - Kühn, E. (2023):
Buchvorstellung "Wer flattert hier?" von Rainer Ulrich
Oedippus 41 , 57 - 57 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2023):
Editorial
Oedippus 41 , 5 - 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2023):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2022
Oedippus 41 , 6 - 43 - Schmidt, J., Opgenoorth, L., Mao, K., Baniya, C.B., Hofmann, S. (2023):
Molecular phylogeny of mega-diverse Carabus attests late Miocene evolution of alpine environments in the Himalayan-Tibetan Orogen
Sci. Rep. 13 , art. 13272 10.1038/s41598-023-38999-6
2022 (23)
- Bowler, D.E., Callaghan, C.T., Bhandari, N., Henle, K., Barth, M.B., Koppitz, C., Klenke, R., Winter, M., Jansen, F., Bruelheide, H., Bonn, A. (2022):
Temporal trends in the spatial bias of species occurrence records [Dataset]
Dryad 10.5061/dryad.4f4qrfjf4 - Bowler, D.E., Callaghan, C.T., Bhandari, N., Henle, K., Barth, M.B., Koppitz, C., Klenke, R., Winter, M., Jansen, F., Bruelheide, H., Bonn, A. (2022):
Temporal trends in the spatial bias of species occurrence records
Ecography 2022 (8), e06219 10.1111/ecog.06219 - Chiacchio, M., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K. (2022):
Population collapse of Rana temporaria in a high altitude environment? An occupancy study
Nat. sicil. Ser. 4, 46 (1), 77 - 84 10.5281/zenodo.6784730 - Chiacchio, M., Mazoschek, L., Vershinin, V., Berzin, D., Partel, P., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2022):
Distant but similar: Simultaneous drop in the abundance of three independent amphibian communities
Conserv. Sci. Pract. 4 (11), e12835 10.1111/csp2.12835 - Grimm-Seyfarth, A. (2022):
Environmental and training factors affect canine detection probabilities for terrestrial newt surveys
J. Vet. Behav. 57 , 6 - 15 10.1016/j.jveb.2022.07.013 - Haack, N., Borges, P.A.V., Grimm-Seyfarth, A., Schlegel, M., Wirth, C., Bernhard, D., Brunk, I., Henle, K., Pereira, H.M. (2022):
Response of common and rare beetle species to tree species and vertical stratification in a floodplain forest
Insects 13 (2), art. 161 10.3390/insects13020161 - Kühn, E. (2022):
Buchvorstellung: Blütenvielfalt für Insekten. Artenschutz im Natur-Präriegarten für Wildbiene, Schmetterling und Co. (Anke Clark)
Oedippus 40 , 51 - Kühn, E. (2022):
Buchrezension zu: Überflieger: Die vier Leben der Schmetterlinge
Biospektrum 28 (2), 229 10.1007/s12268-022-1740-7 - Kühn, E., Becker, M., Harpke, A., Kühn, I., Kuhlicke, C., Schmitt, T., Settele, J., Musche, M. (2022):
The benefits of counting butterflies - recommendations for a successful citizen science project
Ecol. Soc. 27 (2), art. 38 10.5751/ES-12861-270238 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2022):
Editorial
Oedippus 40 , 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2022):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2021
Oedippus 40 , 6 - 35 - Lausch, A., Schaepman, M.E., Skidmore, A.K., Catana, E., Bannehr, L., Bastian, O., Borg, E., Bumberger, J., Dietrich, P., Glässer, C., Hacker, J.M., Höfer, R., Jagdhuber, T., Jany, S., Jung, A., Karnieli, A., Klenke, R., Kirsten, T., Ködel, U., Kresse, W., Mallast, U., Montzka, C., Möller, M., Mollenhauer, H., Pause, M., Rahman, M., Schrodt, F., Schmullius, C., Schütze, C., Selsam, P., Syrbe, R.-U., Truckenbrodt, S., Vohland, M., Volk, M., Wellmann, T., Zacharias, S., Baatz, R. (2022):
Remote sensing of geomorphodiversity linked to biodiversity — Part III: Traits, processes and remote sensing characteristics
Remote Sens. 14 (9), art. 2279 10.3390/rs14092279 - Márquez, C., Ferreira, C.C., Acevedo, P. (2022):
Driver interactions lead changes in the distribution of imperiled terrestrial carnivores
Sci. Total Environ. 838, Part 2 , art. 156165 10.1016/j.scitotenv.2022.156165 - Pereira, H.M., Junker, J., Fernández, N., Maes, J., Beja, P., Bonn, A., Breeze, T., Brotons, L., Bruelheide, H., Buchhorn, M., Capinha, C., Chow, C., Dietrich, K., Dornelas, M., Dubois, G., Fernandez, M., Frenzel, M., Friberg, N., Fritz, S., Georgieva, I., Gobin, A., Guerra, C., Haande, S., Herrando, S., Jandt, U., Kissling, W.D., Kühn, I., Langer, C., Liquete, C., Lyche Solheim, A., Martí, D., Martin, J.G.C., Masur, A., McCallum, I., Mjelde, M., Moe, J., Moersberger, H., Morán-Ordóñez, A., Moreira, F., Musche, M., Navarro, L.M., Orgiazzi, A., Patchett, R., Penev, L., Pino, J., Popova, G., Potts, S., Ramon, A., Sandin, L., Santana, J., Sapundzhieva, A., Shamoun-Baranes, J., Smets, B., Stoev, P., Tedersoo, L., Tiimann, L., Valdez, J., Vallecillo, S., van Grunsven, R.H.A., Van De Kerchove, R., Villero, D., Visconti, P., Weinhold, C., Zuleger, A.M. (2022):
Europa Biodiversity Observation Network: integrating data streams to support policy
ARPHA Preprints 10.3897/arphapreprints.e81207 - Rakosy, D., Motivans, E., Ştefan, V., Nowak, A., Świerszcz, S., Feldmann, R., Kühn, E., Geppert, C., Venkataraman, N., Sobieraj-Betlińska, A., Grossmann, A., Rojek, W., Pochrząst, K., Cielniak, M., Gathof, A.K., Baumann, K., Knight, T.M. (2022):
Intensive grazing alters the diversity, composition and structure of plant-pollinator interaction networks in Central European grasslands
PLOS One 17 (3), e0263576 10.1371/journal.pone.0263576 - Rakosy, D., Motivans, E., Ştefan, V., Nowak, A., Świerszcz, S., Feldmann, R., Kühn, E., Geppert, C., Venkataraman, N., Sobieraj-Betlińska, A., Grossmann, A., Rojek, W., Pochrząst, K., Cielniak, M., Gathof, A.K., Baumann, K., Knight, T.M. (2022):
Plant cover and plant-pollinator interactions in Central European grasslands (Poland/Czech Republic) [Dataset]
Dryad 10.5061/dryad.wwpzgmsmb - Reinke, B.A., Cayuela, H., Janzen, F.J., Lemaître, J.-F., Gaillard, J.-M., Lawing, A.M., Iverson, J.B., Christiansen, D.G., Martínez-Solano, I., Sánchez-Montes, G., Gutiérrez-Rodríguez, J., Rose, F.L., Nelson, N., Keall, S., Crivelli, A.J., Nazirides, T., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Mori, E., Guiller, G., Homan, R., Olivier, A., Muths, E., Hossack, B.R., Bonnet, X., Pilliod, D.S., Lettink, M., Whitaker, T., Schmidt, B.R., Gardner, M.G., Cheylan, M., Poitevin, F., Golubović, A., Tomović, L., Arsovski, D., Griffiths, R.A., Arntzen, J.W., Baron, J.-P., Le Galliard, J.-F., Tully, T., Luiselli, L., Capula, M., Rugiero, L., McCaffery, R., Eby, L.A., Briggs-Gonzalez, V., Mazzotti, F., Pearson, D., Lambert, B.A., Green, D.M., Jreidini, N., Angelini, C., Pyke, G., Thirion, J.-M., Joly, P., Léna, J.-P., Tucker, A.D., Limpus, C., Priol, P., Besnard, A., Bernard, P., Stanford, K., King, R., Garwood, J., Bosch, J., Souza, F.L., Bertoluci, J., Famelli, S., Grossenbacher, K., Lenzi, O., Matthews, K., Boitaud, S., Olson, D.H., Jessop, T.S., Gillespie, G.R., Clobert, J., Richard, M., Valenzuela-Sánchez, A., Fellers, G.M., Kleeman, P.M., Halstead, B.J., Campbell Grant, E.H., Byrne, P.G., Frétey, T., Le Garff, B., Levionnois, P., Maerz, J.C., Pichenot, J., Olgun, K., Üzüm, N., Avcı, A., Miaud, C., Elmberg, J., Brown, G.P., Shine, R., Bendik, N.F., O’Donnell, L., Davis, C.L., Lannoo, M.J., Stiles, R.M., Cox, R.M., Reedy, A.M., Warner, D.A., Bonnaire, E., Grayson, K., Ramos-Targarona, R., Baskale, E., Muñoz, D., Measey, J., de Villiers, F.A., Selman, W., Ronget, V., Bronikowski, A.M., Miller, D.A.W. (2022):
Diverse aging rates in ectothermic tetrapods provide insights for the evolution of aging and longevity
Science 376 (6600), 1459 - 1466 10.1126/science.abm0151 - Settele, J., Harpke, A., Feldmann, R., Musche, M., Kühn, E. (2022):
Citizen Science und Insektenschutz – Die Rolle Ehrenamtlicher am Beispiel des Tagfalter-Monitorings Deutschland
In: Husemann, M., Thaut, L., Leopold, F., Hartung, V., Lohrmann, V., Barilaro, C., Michalik, P., Iglhaut, S. (Hrsg.)
Facettenreiche Insekten: Vielfalt, Gefährdung, Schutz
Haupt, Bern, S. 224 - 232 - Slabbert, E.L., Knight, T.M., Wubet, T., Kautzner, A., Baessler, C., Auge, H., Roscher, C., Schweiger, O. (2022):
Abiotic factors are more important than land management and biotic interactions in shaping vascular plant and soil fungal communities
Glob. Ecol. Conserv. 33 , e01960 10.1016/j.gecco.2021.e01960 - Svenningsen, C.S., Bowler, D.E., Hecker, S., Bladt, J., Grescho, V., van Dam, N.M., Dauber, J., Eichenberg, D., Ejrnæs, R., Fløjgaard, C., Frenzel, M., Frøslev, T.G., Hansen, A.J., Heilmann-Clausen, J., Huang, Y., Larsen, J.C., Menger, J., Binti Mat Nayan, N.L., Pedersen, L.B., Richter, A., Dunn, R.R., Tøttrup, A.P., Bonn, A. (2022):
Flying insect biomass is negatively associated with urban cover in surrounding landscapes
Version: 1 Zenodo 10.5281/zenodo.6416236 - Svenningsen, C.S., Bowler, D.E., Hecker, S., Bladt, J., Grescho, V., van Dam, N.M., Dauber, J., Eichenberg, D., Ejrnæs, R., Fløjgaard, C., Frenzel, M., Frøslev, T.G., Hansen, A.J., Heilmann-Clausen, J., Huang, Y., Larsen, J.C., Menger, J., Binti Mat Nayan, N.L., Pedersen, L.B., Richter, A., Dunn, R.R., Tøttrup, A.P., Bonn, A. (2022):
Flying insect biomass is negatively associated with urban cover in surrounding landscapes
Divers. Distrib. 28 (6), 1242 - 1254 10.1111/ddi.13532 - Svenningsen, C.S., Bowler, D.E., Hecker, S., Bladt, J., Grescho, V., van Dam, N.M., Dauber, J., Eichenberg, D., Ejrnæs, R., Fløjgaard, C., Frenzel, M., Frøslev, T.G., Hansen, A.J., Heilmann-Clausen, J., Huang, Y., Larsen, J.C., Menger, J., Binti Mat Nayan, N.L., Pedersen, L.B., Richter, A., Dunn, R.R., Tøttrup, A.P., Bonn, A. (2022):
Flying insect biomass is negatively associated with urban cover in surrounding landscapes [Dataset]
Dryad 10.5061/dryad.547d7wm9f - van Swaay, C.A.M., Dennis, E.B., Schmucki, R., Sevilleja, C.G., Åström, S., Balalaikins, M., Barea-Azcón, J.M., Bonelli, S., Botham, M., Cancela, J.P., Collins, S., De Flores, M., Dapporto, L., Dopagne, C., Dziekanska, I., Escobés, R., Faltynek Fric, Z., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Glogovčan, P., Gracianteparaluceta, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Houard, X., Judge, M., Kolev, Z., Komac, B., Kühn, E., Kuussaari, M., Lang, A., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Munguira, M.L., Musche, M., Olivares, F.J., Õunap, E., Ozden, O., Pavlíčko, A., Pendl, M., Pettersson, L.B., Rákosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Scalercio, S., Settele, J., Sielezniew, M., Sobczyk-Moran, G., Stefanescu, C., Švitra, G., Szabadfalvi, A., Tiitsaar, A., Titeux, N., Tzirkalli, E., Ubach, A., Verovnik, R., Vray, S., Warren, M.S., Wynhoff, I., Roy, D.B. (2022):
European grassland butterfly indicator 1990-2020 Technical report. Butterfly Conservation Europe & SPRING/eBMS
VS2022.039
De Vlinderstichting, Wageningen, 27 pp.
2021 (21)
- Biffi, S., Traldi, R., Crezee, B., Beckmann, M., Egli, L., Epp Schmidt, D., Motzer, N., Okumah, M., Seppelt, R., Slabbert, E.L., Tiedeman, K., Wang, H., Ziv, G. (2021):
Aligning agri-environmental subsidies and environmental needs: a comparative analysis between the US and EU
Environ. Res. Lett. 16 (5), art. 054067 10.1088/1748-9326/abfa4e - Bruelheide, H., Jansen, F., Jandt, U., Bernhardt-Römermann, M., Bonn, A., Bowler, D., Dengler, J., Eichenberg, D., Grescho, V., Kellner, S., Klenke, R.A., Lütt, S., Lüttgert, L., Sabatini, F.M., Wesche, K. (2021):
A checklist for using Beals’ index with incomplete floristic monitoring data. Reply to Christensen et al. (2021): Problems in using Beals’ index to detect species trends in incomplete floristic monitoring data
Divers. Distrib. 27 (7), 1328 - 1333 10.1111/ddi.13277 - Chiacchio, M., Grimm-Seyfarth, A., Partel, P., Henle, K. (2021):
New altitudinal breeding record for the common toad (Bufo bufo) in the Dolomites
Studi Trentini di Scienze Naturali 101 , 83 - 85 - Contardo, J., Grimm-Seyfarth, A., Cattan, P.E., Schüttler, E. (2021):
Environmental factors regulate occupancy of free-ranging dogs on a sub-Antarctic island, Chile
Biol. Invasions 23 (3), 677 - 691 10.1007/s10530-020-02394-3 - Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds., 2021):
Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales
Wildlife Research Monographs 4
Springer, Cham, 473 pp. 10.1007/978-3-030-81085-6 - Ferreira, C.C., Stephenson, P.J., Gill, M., Regan, E.C. (2021):
Biodiversity monitoring and the role of scientists in the twenty-first century
In: Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds.)
Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales
Wildlife Research Monographs 4
Springer, Cham, p. 25 - 50 10.1007/978-3-030-81085-6_2 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W., Berger, A. (2021):
Detection dogs in nature conservation: A database on their world-wide deployment with a review on breeds used and their performance compared to other methods
Methods Ecol. Evol. 12 (4), 568 - 579 10.1111/2041-210X.13560 - Haack, N., Grimm-Seyfarth, A., Schlegel, M., Wirth, C., Bernhard, D., Brunk, I., Henle, K. (2021):
Patterns of richness across forest beetle communities—A methodological comparison of observed and estimated species numbers
Ecol. Evol. 11 (1), 626 - 635 10.1002/ece3.7093 - Hofmann, S., Baniya, C.B., Stöck, M., Podsiadlowski, L. (2021):
De novo assembly, annotation, and analysis of transcriptome data of the Ladakh Ground skink provide genetic information on high-altitude adaptation
Genes 12 (9), art. 1423 10.3390/genes12091423 - Hofmann, S., Masroor, R., Jablonski, D. (2021):
Morphological and molecular data on tadpoles of the westernmost Himalayan spiny frog Allopaa hazarensis (Dubois & Khan, 1979)
ZooKeys (1049), 67 - 77 10.3897/zookeys.1049.66645 - Klütsch, C.F.C., Ferreira, C.C. (2021):
Closing the gap between knowledge and implementation in conservation science: Concluding remarks
In: Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds.)
Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales
Wildlife Research Monographs 4
Springer, Cham, p. 457 - 473 10.1007/978-3-030-81085-6_15 - Kolora, S.R.R., Gysi, D.M., Schaffer, S., Grimm-Seyfarth, A., Szabolcs, M., Faria, R., Henle, K., Stadler, P.F., Schlegel, M., Nowick, K. (2021):
Accelerated evolution of tissue-specific genes mediates divergence amidst gene flow in European green lizards
Genome Biol. Evol. 13 (8), evab109 10.1093/gbe/evab109 - Kühn, E., Becker, M., Harpke, A., Kühn, I., Kuhlicke, C., Schmitt, T., Settele, J., Musche, M. (2021):
Butterfly monitoring Germany - the benefits of counting butterflies
In: Schröder, B., Richter, D., Borchert, V., Hogreve, J. (eds.)
Ecology - science in transition, science for transition: Book of abstracts, 50th anniversary conference, 30 August – 1 September 2021, Braunschweig
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 50
Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Berlin, 62 10.24355/dbbs.084-202108120758-0 - Kühn, E. (2021):
Spazieren gehen in den Diensten der Wissenschaft – 13 Jahre Tagfalter-Monitoring Deutschland (TMD)
In: Ludwig, H., Grunewald, R., Bernd, A., Züghart, W. (Hrsg.)
Citizen Science und Insekten. Welchen Beitrag kann bürgerschaftliches Engagement für das Insektenmonitoring leisten? Dokumentation des gleichnamigen Workshops
BfN-Skripten 578
Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 47 - 48 10.19217/skr578 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2021):
Editorial
Oedippus 39 , 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2021):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2020
Oedippus 39 , 6 - 35 - Nguyen, V.M., Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (2021):
The knowledge-implementation gap in conservation science
In: Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds.)
Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales
Wildlife Research Monographs 4
Springer, Cham, p. 3 - 21 10.1007/978-3-030-81085-6_1 - Saavedra-Aracena, L., Grimm-Seyfarth, A., Schüttler, E. (2021):
Do dog-human bonds influence movements of free-ranging dogs in wilderness?
Appl. Anim. Behav. Sci. 241 , art. 105358 10.1016/j.applanim.2021.105358 - Sommerwerk, N., Geschke, J., Schliep, R., Esser, J., Glöckler, F., Grossart, H.-P., Hand, R., Kiefer, S., Kimmig, S., Koch, A., Kühn, E., Larondelle, N., Lehmann, G., Munzinger, S., Rödl, T., Werner, D., Wessel, M., Vohland, K. (2021):
Vernetzung und Kooperation ehrenamtlicher und akademischer Forschung im Rahmen des nationalen Biodiversitätsmonitorings: Herausforderungen und Lösungsstrategien. Networking and cooperation of voluntary and academic research within the framework of national biodiversity monitoring – challenges and solution strategies
Natursch. Landschaftspl. 53 (8), 30 - 36 10.1399/NuL.2021.08.03 - Thompson, A., Frenzel, M., Schweiger, O., Musche, M., Groth, T., Roberts, S.P.M., Kuhlmann, M., Knight, T.M. (2021):
Pollinator sampling methods influence community patterns assessments by capturing species with different traits and at different abundances
Ecol. Indic. 132 , art. 108284 10.1016/j.ecolind.2021.108284 - Watt, C.M., Kierepka, E.M., Ferreira, C.C., Koen, E.L., Row, J.R., Bowman, J., Wilson, P.J., Murray, D.L. (2021):
Canada lynx (Lynx canadensis) gene flow across a mountain transition zone in western North America
Can. J. Zool. 99 (2), 131 - 140 10.1139/cjz-2019-0247
2020 (23)
- Auliya, M., Hofmann, S., Segniagbeto, G.H., Assou, D., Ronfot, D., Astrin, J.J., Forat, S., Ketoh, G.K.K., D’Cruze, N. (2020):
The first genetic assessment of wild and farmed ball pythons (Reptilia, Serpentes, Pythonidae) in southern Togo
Nat. Conserv.-Bulgaria (38), 37 - 59 10.3897/natureconservation.38.49478 - Bose, A., Dürr, T., Klenke, R.A., Henle, K. (2020):
Assessing the spatial distribution of avian collision risks at wind turbine structures in Brandenburg, Germany
Conserv. Sci. Pract. 2 (6), e199 10.1111/csp2.199 - Bose, A., Dürr, T., Klenke, R.A., Henle, K. (2020):
Predicting strike susceptibility and collision patterns of the common buzzard at wind turbine structures in the federal state of Brandenburg, Germany
PLOS One 15 (1), e0227698 10.1371/journal.pone.0227698 - Chiacchio, M., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Mihoub, J.-B. (2020):
Water availability as a major climatic driver of taxonomic and functional diversity in a desert reptile community
Ecosphere 11 (7), e03190 10.1002/ecs2.3190 - Eichenberg, D., Bernhardt-Römermann, M., Bowler, D., Bruelheide, H., Conze, K.-J., Dauber, J., Dengler, J., Engels, D., Fartmann, T., Frank, D., Geske, C., Grescho, V., Harter, D., Henle, K., Hofmann, S., Jandt, U., Jansen, F., Kamp, J., Kautzner, A., König-Ries, B., Krämer, R., Krüß, A., Kühl, H., Ludwig, M., Lueg, H., May, R., Musche, M., Opitz, A., Ronnenberg, K., Schacherer, A., Schäffler, L., Schiffers, K., Schulte, U., Schwarz, J., Sperle, T., Stab, S., Stöck, M., Theves, F., Trockur, B., Wesche, K., Wessel, M., Winter, M., Wirth, C., Bonn, A. (2020):
Langfristige Biodiversitätsveränderungen in Deutschland erkennen - mit Hilfe der Vergangenheit in die Zukunft schauen. Recognising long-term changes in biodiversity in Germany - Exploring the future with the help of the past
Nat. Landsch. 95 (11), 479 - 491 10.17433/11.2020.50153851.479-491 - Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2020):
Exceptional occurrences of double, triple and quintuple tails in an Australian lizard community, with a review of supernumerary tails in natural populations of reptiles
Salamandra 56 (4), 373 - 391 - Hofmann, S. (2020):
A new record of Gloydius strauchi (Viperidae, Crotalinae) from Dêgê County, NW Sichuan, China and symptoms of that species’ bite
Russ. J. Herpetol. 27 (2), 113 - 122 10.30906/1026-2296-2020-27-2-113-122 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2020):
Editorial
Oedippus 38 , 5 - 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2020):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2019
Oedippus 38 , 6 - 40 - Kühn, E. (2020):
Tagfalter als Indikatoren für den Biodiversitätsverlust im Grünland
In: Spreen, D., Kandarr, J., Jorzik, O. (Hrsg.)
Biodiversität im Meer und an Land: vom Wert biologischer Vielfalt, (ESKP-Themenspezial: Biodiversität)
ESKP Earth System Knowledge Platform Wissensplattform Erde und Umwelt, Potsdam, S. 104 - 107 10.2312/eskp.2020.1.4.6 - Kühn, E. (2020):
„Spazieren gehen im Dienste der Wissenschaft“ – seit 15 Jahren zählen Falterfreunde ehrenamtlich Tagfalter
In: Züghart, W., Reiter, K., Metzmacher, A. (Hrsg.)
Monitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes: Beiträge der Tagung „Erfahrungsaustausch zu Monitoringkonzepten auf Flächen des Nationalen Naturerbes“ des Bundesamts für Naturschutz vom 01.-04. Juli 2019 an der Internationalen Naturschutzakademie (INA) Insel Vilm
BfN-Skripten 587
Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 123 - 126 10.19217/skr587 - Lin, Y.-P., Schmeller, D.S., Ding, T.-S., Wang, Y.C., Lien, W.-Y., Henle, K., Klenke, R.A. (2020):
A GIS-based policy support tool to determine national responsibilities and priorities for biodiversity conservation
PLOS One 15 (12), e0243135 10.1371/journal.pone.0243135 - Mazoschek, L., Grimm-Seyfarth, A. (2020):
Lissotriton vulgaris (Smooth Newt). Tail bifurcation and ectromely. Natural history notes
Herpetol. Rev. 51 (3), 556 - 557 - Middleton-Welling, J., Dapporto, L., García-Barros, E., Wiemers, M., Nowicki, P., Plazio, E., Bonelli, S., Zaccagno, M., Šašić, M., Liparova, J., Schweiger, O., Harpke, A., Musche, M., Settele, J., Schmucki, R., Shreeve, T. (2020):
A new comprehensive trait database of European and Maghreb butterflies, Papilionoidea
Sci. Data 7 , art. 351 10.1038/s41597-020-00697-7 - Musche, M., Feldmann, R., Harpke, A., Kühn, E., Settele, J. (2020):
Tagfalter-Monitoring Deutschland – Methoden der Auswertung und ausgewählte Ergebnisse
In: Züghart, W., Stenzel, S., Fritsche, B. (Hrsg.)
Umfassendes bundesweites Biodiversitätsmonitoring: Ergebnisse einer Vilmer Fachtagung
BfN-Skripten 585
Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 143 - 150 10.19217/skr585 - Nemitz-Kliemchen, M., Andres, C., Hofmann, S., Prieto Ramírez, A.M., Stoev, P., Tzankov, N., Schaffer, S., Bernhard, D., Henle, K., Schlegel, M. (2020):
Spatial and genetic structure of a Lacerta viridis metapopulation in a fragmented landscape in Bulgaria
Glob. Ecol. Conserv. 23 , e01104 10.1016/j.gecco.2020.e01104 - Pellissier, V., Schmucki, R., Pe'er, G., Aunins, A., Brereton, T.M., Brotons, L., Carnicer, J., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., del Moral, J.C., Escandell, V., Evans, D., Foppen, R., Harpke, A., Heliölä, J., Herrando, S., Kuussaari, M., Kühn, E., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Moshøj, C.M., Musche, M., Noble, D., Oliver, T.H., Reif, J., Richard, D., Roy, D.B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Teufelbauer, N., Touroult, J., Trautmann, S., van Strien, A.J., van Swaay, C.A.M., Van Turnhout, C., Vermouzek, Z., Voříšek, P., Jiguet, F., Julliard, R. (2020):
Effects of Natura 2000 on nontarget bird and butterfly species based on citizen science data
Conserv. Biol. 34 (3), 666 - 676 10.1111/cobi.13434 - Reinhardt, R., Harpke, A., Caspari, S., Dolek, M., Kühn, E., Musche, M., Trusch, R., Wiemers, M., Settele, J. (2020):
Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Ulmer, Stuttgart, 428 S. - Roitberg, E.S., Orlova, V.F., Bulakhova, N.A., Kuranova, V.N., Eplanova, G.V., Zinenko, O.I., Arribas, O., Kratochvíl, L., Ljubisavljević, K., Starikov, V.P., Strijbosch, H., Hofmann, S., Leontyeva, O.A., Böhme, W. (2020):
Variation in body size and sexual size dimorphism in the most widely ranging lizard: testing the effects of reproductive mode and climate
Ecol. Evol. 10 (11), 4531 - 4561 10.1002/ece3.6077 - Slabbert, E.L., Schweiger, O., Wubet, T., Kautzner, A., Baessler, C., Auge, H., Roscher, C., Knight, T.M. (2020):
Scale-dependent impact of land management on above- and belowground biodiversity
Ecol. Evol. 10 (18), 10139 - 10149 10.1002/ece3.6675 - Thrän, D., Bunzel, K., Bovet, J., Eichhorn, M., Hennig, C., Keuneke, R., Kinast, P., Klenke, R., Koblenz, B., Lorenz, C., Majer, S., Manske, D., Massmann, E., Oehmichen, G., Peters, W., Reichmuth, M., Sachs, M.S., Scheftelowitz, M., Schinkel, B., Schiffler, A., Thylmann, M. (2020):
Naturschutzfachliches Monitoring des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strombereich und Entwicklung von Instrumenten zur Verminderung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft („EE-Monitor“)
BfN-Skripten 562
Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, 318 S. 10.19217/skr562 - van Swaay, C.A.M., Dennis, E.B., Schmucki, R., Sevilleja, C.G., Aghababyan, K., Åström, S., Balalaikins, M., Bonelli, S., Botham, M., Bourn, N., Brereton, T., Cancela, J.P., Carlisle, B., Collins, S., Dopagne, C., Dziekanska, I., Escobés, R., Faltynek Fric, Z., Feldmann, R., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Goloshchapova, S., Gracianteparaluceta, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Khanamirian, G., Kolev, Z., Komac, B., Krenn, H., Kühn, E., Lang, A., Leopold, P., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Munguira, M.L., Musche, M., Õunap, E., Ozden, O., Paramo, F., Pavlíčko, A., Pettersson, L.B., Piqueray, J., Prokofev, I., Rákosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Settele, J., Sielezniew, M., Stefanescu, C., Švitra, G., Szabadfalvi, A., Teixeira, S.M., Tiitsaar, A., Tzirkalli, E., Verovnik, R., Warren, M.S., Wynhoff, I., Roy, D.B. (2020):
Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018 Technical report
Butterfly Conservation Europe, Wageningen, 56 pp. - Züghart, W., Planek, J., Kühn, E. (2020):
Arbeitsgruppe: Schritte hin zu einem Monitoring-Modul Tagfalter
In: Züghart, W., Reiter, K., Metzmacher, A. (Hrsg.)
Monitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes: Beiträge der Tagung „Erfahrungsaustausch zu Monitoringkonzepten auf Flächen des Nationalen Naturerbes“ des Bundesamts für Naturschutz vom 01.-04. Juli 2019 an der Internationalen Naturschutzakademie (INA) Insel Vilm
BfN-Skripten 587
Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 127 - 128 10.19217/skr587
2019 (18)
- Ferreira, C.C., Hossie, T.J., Jenkins, D.A., Wehtje, M., Austin, C.E., Boudreau, M.R., Chan, K., Clement, A., Hrynyk, M., Longhi, J., MacFarlane, S., Majchrzak, Y.N., Otis, J.-A., Peers, M.J.L., Rae, J., Seguin, J.L., Walker, S., Watt, C., Murray, D.L. (2019):
The recovery illusion: What is delaying the rescue of imperiled species?
Bioscience 69 (12), 1028 - 1034 10.1093/biosci/biz113 - Grimm-Seyfarth, A., Chiacchio, M., Henle, K. (2019):
Einfluss von Wintertourismus auf montane herpetologische Artengemeinschaften in Europa
Elaphe 2019 (5), 89 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W. (2019):
Evaluierung von Artenspürhunden beim Monitoring von Amphibien und Reptilien
Jahresschrift für Feldherpetologie und Ichthyofaunistik in Sachsen 20 , 56 - 69 - Grimm-Seyfarth, A., Klenke, R. (2019):
Wie findet man schwer zu erfassende Arten? Vorteile und Limitierungen von Artenspürhunden
In: Schüler, C., Kaul, P. (Hrsg.)
Faszinosum Spürhunde - Dem Geruch auf der Spur. Tagungsergebnisse des 4. Symposiums für Odorologie im Diensthundewesen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Schriften der Arbeitsgemeinschaft Odorologie e.V. Band 2
Verlag Dr. Kovač, Hamburg, S. 40 - 47 - Grimm-Seyfarth, A., Mihoub, J.-B., Henle, K. (2019):
Functional traits determine the different effects of prey, predators, and climatic extremes on desert reptiles
Ecosphere 10 (9), e02865 10.1002/ecs2.2865 - Grimm-Seyfarth, A., Zarzycka, A., Nitz, T., Heynig, L., Weissheimer, N., Lampa, S., Klenke, R. (2019):
Performance of detection dogs and visual searches for scat detection and discrimination amongst related species with identical diets
Nat. Conserv.-Bulgaria (37), 81 - 98 10.3897/natureconservation.37.48208 - Halliday, B., Grimm-Seyfarth, A. (2019):
A new species of Ophiomegistus Banks (Acari: Paramegistidae) from an Australian lizard
Syst. Appl. Acarol. 24 (12), 2348 - 2357 10.11158/saa.24.12.5 - Hofmann, S., Baniya, C.B., Litvinchuk, S.N., Miehe, G., Li, J.-T., Schmidt, J. (2019):
Phylogeny of spiny frogs Nanorana (Anura: Dicroglossidae) supports a Tibetan origin of a Himalayan species group
Ecol. Evol. 9 (24), 14498 - 14511 10.1002/ece3.5909 - Hofmann, S., Kuhl, H., Baniya, C.B., Stöck, M. (2019):
Multi-tissue transcriptomes yield information on high-altitude adaptation and sex-determination in Scutiger cf. sikimmensis
Genes 10 (11), art. 873 10.3390/genes10110873 - Kolora, S.R.R., Weigert, A., Saffari, A., Kehr, S., Costa, M.B.W., Spröer, C., Indrischek, H., Chintalapati, M., Lohse, K., Doose, G., Overmann, J., Bunk, B., Bleidorn, C., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Nowick, K., Faria, R., Stadler, P.F., Schlegel, M. (2019):
Divergent evolution in the genomes of closely related lacertids, Lacerta viridis and L. bilineata, and implications for speciation
GigaScience 8 (2), giy160 10.1093/gigascience/giy160 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Ulbrich, K., Wiemers, M., Settele, J. (2019):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2018
Oedippus 36 , 6 - 38 - Litvinchuk, S.N., Melnikov, D.A., Borkin, L.J., Hofmann, S. (2019):
Rediscovery of the high altitude lazy toad, Scutiger occidentalis Dubois, 1978, in India
Russ. J. Herpetol. 26 (1), 17 - 22 10.30906/1026-2296-2019-26-1-17-22 - Musche, M., Adamescu, M., Angelstam, P., Bacher, S., Bäck, J., Buss, H.L., Duffy, C., Flaim, G., Gaillardet, J., Giannakis, G.V., Haase, P., Halada, L., Kissling, W.D., Lundin, L., Matteucci, G., Meesenburg, H., Monteith, D., Nikolaidis, N.P., Pipan, T., Pyšek, P., Rowe, E.C., Roy, D.B., Sier, A., Tappeiner, U., Vilà, M., White, T., Zobel, M., Klotz, S. (2019):
Research questions to facilitate the future development of European long-term ecosystem research infrastructures: A horizon scanning exercise
J. Environ. Manage. 250 , art. 109479 10.1016/j.jenvman.2019.109479 - Pinheiro, A., de Sousa-Pereira, P., Almeida, T., Ferreira, C.C., Otis, T., Boudreau, M.R., Seguin, J.L., Lanning, D.K., Esteves, P.J. (2019):
Sequencing of VDJ genes in Lepus americanus confirms a correlation between VHn expression and the leporid species continent of origin
Mol. Immunol. 112 , 182 - 187 10.1016/j.molimm.2019.05.008 - Rada, S., Schweiger, O., Harpke, A., Kühn, E., Kuras, T., Settele, J., Musche, M. (2019):
Protected areas do not mitigate biodiversity declines: A case study on butterflies
Divers. Distrib. 25 (2), 217 - 224 10.1111/ddi.12854 - Tartally, A., Thomas, J.A., Anton, C., Balletto, E., Barbero, F., Bonelli, S., Bräu, M., Casacci, L.P., Csősz, S., Czekes, Z., Dolek, M., Dziekańska, I., Elmes, G., Fürst, M.A., Glinka, U., Hochberg, M.E., Höttinger, H., Hula, V., Maes, D., Munguira, M.L., Musche, M., Stadel Nielsen, P., Nowicki, P., Oliveira, P.S., Peregovits, L., Ritter, S., Schlick-Steiner, B.C., Settele, J., Sielezniew, M., Simcox, D.J., Stankiewicz, A.M., Steiner, F.M., Švitra, G., Ugelvig, L.V., Van Dyck, H., Varga, Z., Witek, M., Woyciechowski, M., Wynhoff, I., Nash, D.R. (2019):
Patterns of host use by brood parasitic Maculinea butterflies across Europe
Philos. Trans. R. Soc. B-Biol. Sci. 374 , art. 20180202 10.1098/rstb.2018.0202 - Ulbrich, K., Kühn, E., Schweiger, O., Settele, J. (2019):
How many butterflies will lose their habitats? Communicating biodiversity research using the example of European butterflies
In: Zandvliet, D.B. (ed.)
Culture and environment : weaving new connections
Researching environmental learning 4
Brill Sense, Leiden, p. 93 - 106 10.1163/9789004396685_006 - van Swaay, C.A.M., Dennis, E.B., Schmucki, R., Sevilleja, C., Balalaikins, M., Botham, M., Bourn, N., Brereton, T., Cancela, J.P., Carlisle, B., Chambers, P., Collins, S., Dopagne, C., Escobés, R., Feldmann, R., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Gracianteparaluceta, A., Harrower, C., Harpke, A., Heliölä, J., Komac, B., Kühn, E., Lang, A., Maes, D., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Munguira, M.L., Murray, T.E., Musche, M., Õunap, E., Paramo, F., Pettersson, L.B., Piqueray, J., Settele, J., Stefanescu, C., Švitra, G., Tiitsaar, A., Verovnik, R., Warren, M.S., Wynhoff, I., Roy, D.B. (2019):
The EU butterfly indicator for grassland species: 1990-2017. Technical report
Butterfly Conservation Europe, Wageningen, 23 pp.
2018 (20)
- Arfan, M., Pe'er, G., Bauch, B., Settele, J., Henle, K., Klenke, R. (2018):
Evaluating presence data versus expert opinions to assess occurrence, habitat preferences and landscape permeability: a case study of butterflies
Environments 5 (3), art. 36 10.3390/environments5030036 - Bencatel, J., Ferreira, C.C., Barbosa, A.M., Rosalino, L.M., Álvares, F. (2018):
Research trends and geographical distribution of mammalian carnivores in Portugal (SW Europe)
PLOS One 13 (11), e0207866 10.1371/journal.pone.0207866 - Betto-Colliard, C., Hofmann, S., Sermier, R., Perrin, N., Stöck, M. (2018):
Profound genetic divergence and asymmetric parental genome contributions as hallmarks of hybrid speciation in polyploid toads
Proc. R. Soc. B-Biol. Sci. 285 (1872 ), art. 20172667 10.1098/rspb.2017.2667 - Böcker, F., Taubmann, J., Grimm-Seyfarth, A. (2018):
Wildlife detection dogs – Einsatz und Grenzen von Artenspürhunden in Wildtierforschung und Naturschutz
In: König, A., Arnold, J., Suchant, R., Sandrini, M. (Hrsg.)
Wildbiologische Forschungsberichte. Tagungsbeiträge: Wildtierökologische Forschung für die Praxis - Vom Monitoring bis zum Management - (2018 im Nordschwarzwald)
Schriftenreihe der Vereinigung der Wildbiologen und Jagdwissenschaftler Deutschlands 3
Kessel, Remagen-Oberwinter, S. 47 - 50 - Bose, A., Duerr, T., Klenke, R.A., Henle, K. (2018):
Collision sensitive niche profile of the worst affected bird-groups at wind turbine structures in the Federal State of Brandenburg, Germany
Sci. Rep. 8 , art. 3777 10.1038/s41598-018-22178-z - Delibes-Mateos, M., Castro, F., Piorno, V., Ramírez, E., Blanco-Aguiar, J.A., Aparicio, F., Mínguez, L.E., Ferreira, C.C., Rouco, C., Ríos-Saldaña, C.A., Recuerda, P., Villafuerte, R. (2018):
First assessment of the potential introduction by hunters of eastern cottontail rabbits (Sylvilagus floridanus) in Spain
Wildl. Res. 45 (7), 571 - 577 10.1071/WR17185 - Grimm-Seyfarth, A. (2018):
Effects of climate change on a reptile community in arid Australia : exploring mechanisms and processes in a hot, dry, and mysterious ecosystem. Auswirkungen von Klimawandel auf eine Reptiliengemeinschaft im ariden Australien : eine Untersuchung von Mechanismen und Prozessen in einem heißen, trockenen, und rätselhaften Ökosystem
Dissertation, Universität Potsdam
195 pp. - Grimm-Seyfarth, A., Mihoub, J.-B., Gruber, B., Henle, K. (2018):
Some like it hot: from individual to population responses of an arboreal arid‐zone gecko to local and distant climate
Ecol. Monogr. 88 (3), 336 - 352 10.1002/ecm.1301 - Haase, P., Tonkin, J.D., Stoll, S., Burkhardt, B., Frenzel, M., Geijzendorffer, I.R., Häuser, C., Klotz, S., Kühn, I., McDowell, W.H., Mirtl, M., Müller, F., Musche, M., Penner, J., Zacharias, S., Schmeller, D.S. (2018):
The next generation of site-based long-term ecological monitoring: Linking essential biodiversity variables and ecosystem integrity
Sci. Total Environ. 613–614 , 1376 - 1384 10.1016/j.scitotenv.2017.08.111 - Hofmann, S., Mebert, K., Schulz, K.-D., Helfenberger, N., Göçmen, B., Böhme, W. (2018):
A new subspecies of Zamenis hohenackeri (Strauch, 1873) (Serpentes: Colubridae) based on morphological and molecular data
Zootaxa 4471 (1), 137 - 153 10.11646/zootaxa.4471.1.6 - Kühn, E. (2018):
Spazieren gehen für die Wissenschaft
MINT-Zirkel : Zeitung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 7 (1), 1 - 2 - Kühn, E. (2018):
Nachruf: Dr. Helga Göttsche
Oedippus 35 , 48 - Kühn, E. (2018):
Vorstellung Fotokalender „Schmetterlinge an Gräsern“ von Andreas Kolossa
Oedippus 35 , 46 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2018):
Editorial
Oedippus 35 , 4 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Wiemers, M., Feldmann, R., Settele, J. (2018):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2017
Oedippus 35 , 5 - 36 - Lausch, A., Borg, E., Bumberger, J., Dietrich, P., Heurich, M., Huth, A., Jung, A., Klenke, R., Knapp, S., Mollenhauer, H., Paasche, H., Paulheim, H., Pause, M., Schweitzer, C., Schmullius, C., Settele, J., Skidmore, A.K., Wegmann, M., Zacharias, S., Kirsten, T., Schaepman, M.E. (2018):
Understanding forest health with remote sensing, Part III: Requirements for a scalable multi-source forest health monitoring network based on data science approaches
Remote Sens. 10 (7), art. 1120 10.3390/rs10071120 - Menger, J., Unrein, J., Woitow, M., Schlegel, M., Henle, K., Magnusson, W.E. (2018):
Weak evidence for fine-scale genetic spatial structure in three sedentary Amazonian understorey birds. Schwache Hinweise auf eine räumlich-genetische Feinstruktur bei drei sesshaften Vögeln aus dem Unterholz des Amazonas Waldes
J. Ornithol. 159 (2), 355 - 366 10.1007/s10336-017-1507-y - Richter, A., Hauck, J., Feldmann, R., Kühn, E., Harpke, A., Hirneisen, N., Mahla, A., Settele, J., Bonn, A. (2018):
The social fabric of citizen science - drivers for long-term engagement in the German butterfly monitoring scheme
J. Insect Conserv. 22 (5-6), 731 - 743 10.1007/s10841-018-0097-1 - Ríos-Saldaña, C.A., Delibes-Mateos, M., Ferreira, C.C. (2018):
Are fieldwork studies being relegated to second place in conservation science?
Glob. Ecol. Conserv. 14 , e00389 10.1016/j.gecco.2018.e00389 - Zhang, C., Harpke, A., Kühn, E., Páramo, F., Settele, J., Stefanescu, C., Wiemers, M., Zhang, Y., Schweiger, O. (2018):
Applicability of butterfly transect counts to estimate species richness in different parts of the palaearctic region
Ecol. Indic. 95 (Part 1), 735 - 740 10.1016/j.ecolind.2018.08.027
2017 (23)
- Grimm-Seyfarth, A., Klenke, R. (2017):
Suchhunde im Naturschutz: Geruchsunterscheidung zwischen nahe verwandten Arten mit identischer Diät
In: Schüler, C., Kaul, P. (Hrsg.)
Faszinosum Spürhunde: Gefahren sichtbar machen – Gefahren abwenden. Tagungsergebnisse des 3. Symposiums für Odorologie im Diensthundewesen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Schriften der Arbeitsgemeinschaft Odorologie e.V. Band 1
Verlag Dr. Kovač, Hamburg, S. 253 - 266 - Grimm-Seyfarth, A., Mihoub, J.-B., Henle, K. (2017):
Too hot to die? The effects of vegetation shading on past, present, and future activity budgets of two diurnal skinks from arid Australia
Ecol. Evol. 7 (17), 6803 - 6813 10.1002/ece3.3238 - Gunton, R.M., Marsh, C.J., Moulherat, S., Malchow, A.-K., Bocedi, G., Klenke, R.A., Kunin, W.E. (2017):
Multicriterion trade-offs and synergies for spatial conservation planning
J. Appl. Ecol. 54 (3), 903 - 913 10.1111/1365-2664.12803 - Henle, K., Andres, C., Bernhard, D., Grimm, A., Stoev, P., Tzankov, N., Schlegel, M. (2017):
Are species genetically more sensitive to habitat fragmentation on the periphery of their range compared to the core? A case study on the sand lizard (Lacerta agilis)
Landsc. Ecol. 32 (1), 131 - 145 10.1007/s10980-016-0418-2 - Hofmann, S., Everaars, J., Frenzel, M., Bannehr, L., Cord, A.F. (2017):
Modelling patterns of pollinator species richness and diversity using satellite image texture
PLOS One 12 (10), e0185591 10.1371/journal.pone.0185591 - Hofmann, S., Stöck, M., Zheng, Y., Ficetola, G.F., Li, J.-T., Scheidt, U., Schmidt, J. (2017):
Molecular phylogenies indicate a Paleo-Tibetan origin of Himalayan lazy toads (Scutiger)
Sci. Rep. 7 , art. 3308 10.1038/s41598-017-03395-4 - Klenke, R., Frey, B., Zarzycka, A. (2017):
Chapter 9. Case study 5: The effects of increased rape and maize cropping on agricultural biodiversity
In: Siriwardena, G., Tucker, G. (eds.)
Service contract to support follow-up actions to the mid-term review of the EU biodiversity strategy to 2020 in relation to target 3A – Agriculture. Report to the European Commission
Institute for European Environmental Policy, London, p. 147 - 183 10.2779/981605 - Knapp, S., Schweiger, O., Kraberg, A., Asmus, H., Asmus, R., Brey, T., Frickenhaus, S., Gutt, J., Kühn, I., Liess, M., Musche, M., Pörtner, H.-O., Seppelt, R., Klotz, S., Krause, G. (2017):
Do drivers of biodiversity change differ in importance across marine and terrestrial systems — or is it just different research communities' perspectives?
Sci. Total Environ. 574 , 191 - 203 10.1016/j.scitotenv.2016.09.002 - Kolora, S.R.R., Faria, R., Weigert, A., Schaffer, S., Grimm, A., Henle, K., Sahyoun, A.H., Stadler, P.F., Nowick, K., Bleidorn, C., Schlegel, M. (2017):
The complete mitochondrial genome of Lacerta bilineata and comparison with its closely related congener L. viridis
Mitochondrial DNA 28 (1), 116 - 118 10.3109/19401736.2015.1111349 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Wiemers, M., Feldmann, R., Settele, J. (2017):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2016
Oedippus 34 , 6 - 33 - Le Pendu, J., Abrantes, J., Bertagnoli, S., Guitton, J.-S., Le Gall-Reculé, G., Lopes, A.N., Marchandeau, S., Alda, F., Almeida, T., Célio, A.P., Bárcena, J., Burmakina, G., Blanco, E., Calvete, C., Cavadini, P., Cooke, B., Dalton, K., Delibes Mateos, M., Deptula, W., Eden, J.S., Wang, F., Ferreira, C.C., Ferreira, P., Foronda, P., Gonçalves, D., Gavier-Widén, D., Hall, R., Hukowska-Szematowicz, B., Kerr, P., Kovaliski, J., Lavazza, A., Mahar, J., Malogolovkin, A., Marques, R.M., Marques, S., Martin-Alonso, A., Monterroso, P., Moreno, S., Mutze, G., Neimanis, A., Niedzwiedzka-Rystwej, P., Peacock, D., Parra, F., Rocchi, M., Rouco, C., Ruvoën-Clouet, N., Silva, E., Silvério, D., Strive, T., Thompson, G., Tokarz-Deptula, B., Esteves, P. (2017):
Proposal for a unified classification system and nomenclature of lagoviruses
J. Gen. Virol. 98 (7), 1658 - 1666 10.1099/jgv.0.000840 - Menger, J., Gerth, M., Unrein, J., Henle, K., Schlegel, M. (2017):
Isolation and characterization of pmlymorphic Microsatellite Loci from the Rufous-throated Antbird Gymnopithys rufigula (Aves: Thamnophilidae)
Wilson J. Ornithol. 129 (2), 407 - 411 10.1676/16-062.1 - Menger, J., Henle, K., Magnusson, W.E., Soro, A., Husemann, M., Schlegel, M. (2017):
Genetic diversity and spatial structure of the Rufous-throated Antbird (Gymnopithys rufigula), an Amazonian obligate army-ant follower
Ecol. Evol. 7 (8), 2671 - 2684 10.1002/ece3.2880 - Menger, J., Magnusson, W.E., Anderson, M.J., Schlegel, M., Pe'er, G., Henle, K. (2017):
Environmental characteristics drive variation in Amazonian understorey bird assemblages
PLOS One 12 (2), e0171540 10.1371/JOURNAL.PONE.0171540 - Mills, S.C., Oliver, T.H., Bradbury, R.B., Gregory, R.D., Brereton, T., Kühn, E., Kuussaari, M., Musche, M., Roy, D.B., Schmucki, R., Stefanescu, C., van Swaay, C., Evans, K.L. (2017):
European butterfly populations vary in sensitivity to weather across their geographical ranges
Glob. Ecol. Biogeogr. 26 (12), 1374 - 1385 10.1111/geb.12659 - Murray, D.L., Peers, M.J.L., Majchrzak, Y.N., Wehtje, M., Ferreira, C., Pickles, R.S.A., Row, J.R., Thornton, D.H. (2017):
Continental divide: Predicting climate-mediated fragmentation and biodiversity loss in the boreal forest
PLOS One 12 (5), e0176706 10.1371/journal.pone.0176706 - Ripple, W.J., Wolf, C., Newsome, T.M., Galetti, M., Alamgir, M., Crist, E., Mahmoud, M.I., Laurance, W.F., Auliya, M., Droste, N., Egli, L., Everaars, J., Ferreira, C., Friese, K., Henle, K., Kühn, I., Loyau, A., Pe'er, G., Priess, J.A., Schiller, J., Schmeller, D.S., Schröter, M., Spangenberg, J.H., Wiemers, M., and more, (2017):
World scientists’ warning to humanity: a second notice
Bioscience 67 (12), 1026 - 1028 10.1093/biosci/bix125 - Russ, A., Lučeničová, T., Klenke, R. (2017):
Altered breeding biology of the European blackbird under artificial light at night
J. Avian Biol. 48 (8), 1114 - 1125 10.1111/jav.01210 - Schüttler, E., Klenke, R., Galuppo, S., Castro, R.A., Bonacic, C., Laker, J., Henle, K. (2017):
Habitat use and sensitivity to fragmentation in America’s smallest wildcat
Mamm. Biol. 86 , 1 - 8 10.1016/j.mambio.2016.11.013 - Ulbrich, K., Kühn, E., Settele, J. (2017):
Tagfalter-Monitoring fördert fächerübergreifenden Unterricht
Biologie in unserer Zeit 47 (4), 219 - 220 10.1002/biuz.201770408 - Unrein, J., Menger, J., Weigert, A., Henle, K., Schlegel, M. (2017):
Isolation and characterisation of novel polymorphic microsatellite markers for the Wedge-billed Woodcreeper Glyphorynchus spirurus
Avian Biol. Res. 10 (1), 24 - 26 10.3184/175815617X14799886573066 - van Swaay, C.A.M., Botham, M., Brereton, T., Carlisle, B., Dopagne, C., Escobés, R., Feldmann, R., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Gracianteparaluceta, A., Harpke, A., Heliölä, J., Kühn, E., Lang, A., Maes, D., Mestdagh, X., Monasterio, Y., Munguira, M.L., Murray, T., Musche, M., Õunap, E., Pettersson, L.B., Piqueray, J., Roth, T., Roy, D.B., Schmucki, R., Settele, J., Stefanescu, C., Švitra, G., Tiitsaar, A., Verovnik, R. (2017):
Technical report: making Bioscore distribution models based on Butterfly Monitoring Transects
Report VS2017.029
Dutch Butterfly Conservation, Wageningen, 20 pp. - Zimmermann, A., Knecht, H., Häsler, R., Zissel, G., Gaede, K.I., Hofmann, S., Nebel, A., Müller-Quernheim, J., Schreiber, S., Fischer, A. (2017):
Atopobium and Fusobacterium as novel candidates for sarcoidosis-associated microbiota
Eur. Resp. J. 50 (6), art. 1600746 10.1183/13993003.00746-2016
2016 (11)
- Grimm, A., Gruber, B., Hoehn, M., Enders, K., Henle, K. (2016):
A model-derived short-term estimation method of effective size for small populations with overlapping generations
Methods Ecol. Evol. 7 (6), 734 - 743 10.1111/2041-210X.12530 - Haase, P., Frenzel, M., Klotz, S., Musche, M., Stoll, S. (2016):
The long-term ecological research (LTER) network: Relevance, current status, future perspective and examples from marine, freshwater and terrestrial long-term observation. Editorial
Ecol. Indic. 65 , 1 - 3 10.1016/j.ecolind.2016.01.040 - Hofmann, S., Fritzsche, P., Miehe, G. (2016):
A new record of Elaphe dione from high altitude in Western Sichuan reveals high intraspecific differentiation
Salamandra 52 (3), 273 - 277 - Klenke, R. (2016):
Die dunkle Seite des künstlichen Lichtes –Wo sich Quantenphysik und Naturschutz treffen
PdN-PhiS 65 (7), 29 - 37 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2016):
Editorial
Oedippus 32 , 5 - 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Wiemers, M., Feldmann, R., Settele, J. (2016):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2015
Oedippus 32 , 6 - 33 - Lausch, A., Bannehr, L., Beckmann, M., Boehm, C., Feilhauer, H., Hacker, J.M., Heurich, M., Jung, A., Klenke, R., Neumann, C., Pause, M., Rocchini, D., Schaepman, M.E., Schmidtlein, S., Schulz, K., Selsam, P., Settele, J., Skidmore, A.K., Cord, A.F. (2016):
Linking Earth Observation and taxonomic, structural and functional biodiversity: Local to ecosystem perspectives
Ecol. Indic. 70 , 317 - 339 10.1016/j.ecolind.2016.06.022 - Pettibone, L., Vohland, K., Bonn, A., Richter, A., Bauhus, W., Behrisch, B., Borcherding, R., Brandt, M., Bry, F., Dörler, D., Elbertse, I., Glöckler, F., Göbel, C., Hecker, S., Heigl, F., Herdick, M., Kiefer, S., Kluttig, T., Kühn, E., Kühn, K., Oldorff, S., Oswald, K., Röller, O., Schefels, C., Schierenberg, A., Scholz, W., Schumann, A., Sieber, A., Smolarski, R., Tochtermann, K., Wende, W., Ziegler, D. (2016):
Citizen science for all - a guide for citizen science practitioners. Bürger Schaffen Wissen (GEWISS) publication
Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig ; Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig ; Berlin-Brandenburgisches Institut für Biodiversitätsforschung (BBIB) ; Museum für Naturkunde (MfN) – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin, 60 S. - Pettibone, L., Vohland, K., Bonn, A., Richter, A., Bauhus, W., Behrisch, B., Borcherding, R., Brandt, M., Bry, F., Dörler, D., Elbertse, I., Glöckler, F., Göbel, C., Hecker, S., Heigl, F., Herdick, M., Kiefer, S., Kluttig, T., Kühn, E., Kühn, K., Oldorff, S., Oswald, K., Röller, O., Schefels, C., Schierenberg, A., Scholz, W., Schumann, A., Sieber, A., Smolarski, R., Tochtermann, K., Wende, W., Ziegler, D. (2016):
Citizen Science für alle – eine Handreichung für Citizen Science Akteure. Bürger Schaffen Wissen (GEWISS)-Publikation
Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig ; Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig ; Berlin-Brandenburgisches Institut für Biodiversitätsforschung (BBIB) ; Museum für Naturkunde (MfN) – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin, 60 S. - Schmucki, R., Pe'er, G., Roy, D.B., Stefanescu, C., van Swaay, C.A.M., Oliver, T.H., Kuussaari, M., van Strien, A.J., Ries, L., Settele, J., Musche, M., Carnicer, J., Schweiger, O., Brereton, T., Harpke, A., Heliölä, J., Kühn, E., Julliard, R. (2016):
A regionally informed abundance index for supporting integrative analyses across butterfly monitoring schemes
J. Appl. Ecol. 53 (2), 501 - 510 10.1111/1365-2664.12561 - Suh, A., Witt, C.C., Menger, J., Sadanandan, K.R., Podsiadlowski, L., Gerth, M., Weigert, A., McGuire, J.A., Mudge, J., Edwards, S.V., Rheindt, F.E. (2016):
Ancient horizontal transfers of retrotransposons between birds and ancestors of human pathogenic nematodes
Nat. Commun. 7 , art. 11396 10.1038/ncomms11396
2015 (15)
- Grimm, A., Weiß, B.M., Kulik, L., Mihoub, J.-B., Mundry, R., Köppen, U., Brueckmann, T., Thomsen, R., Widdig, A. (2015):
Earlier breeding, lower success: does the spatial scale of climatic conditions matter in a migratory passerine bird?
Ecol. Evol. 5 (23), 5722 - 5734 10.1002/ece3.1824 - Holzhauer, S.I.J., Franke, S., Kyba, C.C.M., Manfrin, A., Klenke, R., Voigt, C.C., Lewanzik, D., Oehlert, M., Monaghan, M.T., Schneider, S., Heller, S., Kuechly, H., Brüning, A., Honnen, A.-C., Hölker, F. (2015):
Out of the dark: Establishing a large-scale field experiment to assess the effects of artificial light at night on species and food webs
Sustainability 7 (11), 15593 - 15616 10.3390/su71115593 - Klenke, R., Russ, A. (2015):
Schlaflos in der Stadt
Leipzigs Wandel im Spiegel der Stadtforschung am UFZ
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig, S. 12 - 13 - Kühn, E. (2015):
Das TMD Juniors-Treffen 2015
Oedippus 31 , 54 - 55 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2015):
Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2014
Oedippus 31 , 5 - 40 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2015):
Editorial
Oedippus 31 , 4 - 4 - Kühn, E., Wiemers, M., Feldmann, R., Musche, M., Harpke, A., Schweiger, O., Hirneisen, N., Settele, J. (2015):
Tagfalter-Monitoring Deutschland (TMD) und europäische Indikatoren – erste Langzeitergebnisse und ihre Verwendung im Naturschutz
Verantwortung für die Zukunft: Naturschutz im Spannungsfeld gesellschaftlichter Interessen
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege
Bundesverband Beruflicher Naturschutz e. V. , Bonn, S. 98 - 103 - Lampa, S., Mihoub, J.-B., Gruber, B., Klenke, R., Henle, K. (2015):
Non-invasive genetic mark-recapture as a means to study population sizes and marking behaviour of the elusive Eurasian otter (Lutra lutra)
PLOS One 10 (5), e0125684 10.1371/journal.pone.0125684 - Murray, D.L., Majchrzak, Y.N., Peers, M.J.L., Wehtje, M., Ferreira, C., Pickles, R.S.A., Row, J.R., Thornton, D.H. (2015):
Potential pitfalls of private initiatives in conservation planning: A case study from Canada's boreal forest
Biol. Conserv. 192 , 174 - 180 10.1016/j.biocon.2015.09.017 - Russ, A., Reitemeier, S., Weissmann, A., Gottschalk, J., Einspanier, A., Klenke, R. (2015):
Seasonal and urban effects on the endocrinology of a wild passerine
Ecol. Evol. 5 (23), 5698 - 5710 10.1002/ece3.1820 - Russ, A., Rüger, A., Klenke, R. (2015):
Seize the night: European Blackbirds (Turdus merula) extend their foraging activity under artificial illumination
J. Ornithol. 156 (1), 123 - 131 10.1007/s10336-014-1105-1 - Settele, J., Feldmann, R., Kühn, E. (2015):
Tagfalter-Monitoring Deutschland
In: Griesohn-Pflieger, T., Munzinger, S., Schulemann-Maier, G. (Hrsg.)
Praxisbuch Naturgucken: Informationen, Tipps und Tricks
naturgucker.de, Northeim, S. 51 - 53 - Steinicke, H., Gruber, B., Grimm, A., Grosse, W.-R., Henle, K. (2015):
Morphological shifts in populations of generalist and specialist amphibians in response to fragmentation of the Brazilian Atlantic forest
Nat. Conserv.-Bulgaria (13), 47 - 59 10.3897/natureconservation.13.7428 - van Swaay, C.A.M., van Strien, A.J., Aghababyan, K., Åström, S., Botham, M., Brereton, T., Chambers, P., Collins, S., Domènech Ferrés, M., Escobés, R., Feldmann, R., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Goloshchapova, S., Gracianteparaluceta, A., Harpke, A., Heliölä, J., Khanamirian, G., Julliard, R., Kühn, E., Lang, A., Leopold, P., Loos, J., Maes, D., Mestdagh, X., Monasterio, Y., Munguira, M.L., Murray, T., Musche, M., Õunap, E., Pettersson, L., Popoff, S., Prokofev, I., Roth, T., Roy, D., Settele, J., Stefanescu, C., Švitra, G., Teixeira, S.M., Tiitsaar, A., Verovnik, R., Warren, M. (2015):
The European butterfly indicator for grassland species 1990-2013
Report VS 2015.009
De Vlinderstichting, Wageningen, 37 pp. - Vohland, K., Doyle, U., Albert, C., Bertram, C., Biber-Freudenberger, L., Bonn, A., Brenck, M., Burkhard, B., Förster, J., Fuchs, E., Galler, C., von Haaren, C., Ibisch, P.L., Kaphengst, T., Klassert, C., Klenke, R., Klotz, S., Kreft, S., Kühn, I., Marquard, E., Mehl, D., Meinke, I., Naumann, K., Reckermann, M., Rehdanz, K., Rüter, S., Saathoff, W., Sauermann, J., Scholz, M., Schröder, U., Seppelt, R., Thrän, D., Witing, F. (2015):
Ökosystemleistungen, Biodiversität und Klimawandel: Grundlagen
In: Hartje, V., Wüstemann, H., Bonn, A. (Hrsg.)
Naturkapital Deutschland – TEEB DE: Naturkapital und Klimapolitik - Synergien und Konflikte
Technische Universität Berlin ; Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Berlin, Leipzig, S. 66 - 99
