Scientist profiles

Beschäftigt am UFZ: seit 1995
Ausbildung: Studium der Biologie in Marburg, St. Andrews, Freiburg und Bremen
Informeller Lebenslauf:
Das Streben nach Lösungen für Umweltprobleme trieb mich in die Biologie und interdisziplinäre Forschung. Während meines Studiums konzentrierte ich mich auf Pflanzenphysiologie und Stressökologie. Während meines Promotionsprojekts an der Universität Bremen verknüpfte ich Untersuchungen zu Stoffwechselprozessen mit kombinierten Wirkungsstudien zu Pestiziden. Am UFZ lernte ich verschiedene großräumige Kontaminationsprobleme kennen, z.B. kontaminierte Grundwässer auf Landschaftsebene. So haben wir verschiedene Bioassays zum Nachweis von Kontaminationen entwickelt. Das Verständnis von Mischungseffekten und verursachenden Chemikalien ist seitdem mein Forschungsschwerpunkt, wobei ich theoretische und experimentelle Methoden verwende. Seit 2017 leite ich die Forschungseinheit "Chemikalien in der Umwelt".
Forschungsinteressen:
- Analyse der Toxizität von Gemischen: zur Ermittlung von Risikofaktoren bei komplexer Umweltexposition und zur mechanismusbasierten Vorhersage kombinierter Wirkungen
- Analyse der Wirkungsweise: zur Klärung kausaler Beziehungen zwischen biologischen Schlüsselereignissen, zur Entwicklung von Tests für biologische Reaktionen und zur Entwicklung toxikokinetischer und toxikodynamischer Erkenntnisse
- Umweltrisikobewertung: Förderung der Anwendung bioanalytischer Instrumente bei der Bewertung chemischer Gefahren und Risiken, der Produktverantwortung, der Bewertung der Umweltqualität und der Erfolgskontrolle von Sanierungsmaßnahmen
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2006
Ausbildung: Studium der Verfahrenstechnik und Biotechnologie in Dresden und Jena
Informeller Lebenslauf:
Nach ihrem Studium promovierte Wibke Busch im Bereich der Toxikologie/Biochemie am UFZ und der Universität Halle-Wittenberg. Seit 2011 war sie als PostDoc in verschiedenen Projekten tätig. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen für ihre Forschungsarbeiten und leitet derzeit die Arbeitsgruppe „integrative Toxikologie“ am UFZ.
Forschungsinteressen:
- Molekulare Toxikologie
- Toxikogenomik
- Datengesteuerte Ansätze und Bioinformatik in der Toxikologie
- Gefährdungs- und Risikobewertung
- Chemikalienmischungen und kombinierte Wirkungen
- Systemtoxikologie (von der molekularen Störung zum morphologischen Phänotyp)
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2008
Ausbildung: Studium der Biologie in Marburg und Würzburg
Informeller Lebenslauf:
Das Verständnis wie ein Organismus sich entwickelt und welche molekularen Mechanismen koordiniert werden müssen um z.B. Organe mit den jeweiligen Funktionseinheiten auf zellulären Ebenen auszubilden konnte ich in meinem Biologiestudium vertiefen. Seit meiner Diplom- und Promotionsarbeit an der Universität Würzburg konnten mich die entwicklungbiologischen Modelle von Fischen, insbesondere das Zebrabärblingsembryo-Modell, begeistern. Seit 2008 nutze ich am UFZ dieses Modell um den Einfluss von Xenobiotika auf Organismen besser zu verstehen.
Forschungsinteressen:
- Mechanistische Toxikologie
- Molekular- und Entwicklungsbiologie
- Entwicklungsneurotoxizität von Chemikalien unter der Berücksichtigung subletalen Endpunkten, z. B. Bewegungsmustern, Veränderung der Morphologie und der Genexpression
- toxikokinetische und toxikodynamische Prozesse, um die beobachteten Wirkungen mit den internen Konzentrationen im Zebrabärblingsembryo in Zusammenhang zu bringen.
- Verbesserungen und Erhöhung der Akzeptanz des Zebrabärblingsembryo-Modells als Alternative zu Tierversuchen in in-vitro Teststartgien für die Risiko- und Gefahrenbewertung
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2006
Ausbildung: Studium der Biologie in Potsdam
Informeller Lebenslauf:
Während meines Biologiestudiums an der Universität Potsdam kam ich über ein Nebenfach mit der Toxikologie in Berührung, und forsche seitdem in diesem Bereich. Nach einer Promotion im Bereich Ernährungstoxikologie wechselte ich ans UFZ und konnte meine Expertise hier in Umwelt- und Ökotoxikolgie erweitern. Mein besonderes Interesse gilt dabei inzwischen nicht mehr (nur) Chemikalien, sondern vor allem Partikeln. Nano- und mikroskalige Partikel, die ihren Ursprung in menschlichen Aktivitäten haben, sind zum Beispiel technisch hergestellt Nanomaterialen oder Mikroplastikpartikel. Meine Forschungsarbeiten konzentrieren sich darauf, mögliche Effekte solcher Partikel auf aquatische Organismen zu charakterisieren.
Forschungsinteressen:
- Bewertung der (öko)toxikologischen Auswirkungen anthropogener Partikel: technisch hergestellte Nanomaterialien, Nano-/Mikrokunststoff, aus Verbrennungsprozessen stammende Partikel, fortschrittliche/innovative Materialien
- Wechselwirkung zwischen Organismus und Partikeln: Bewertung der Anlagerung, Internalisierung und Verteilung anthropogener Partikel in Umweltorganismen
- Mischungseffekte von anthropogenen Partikeln und chemischen Hilfsstoffen
- Wissenschaft und Risikokommunikation über die Umweltsicherheit anthropogener Partikel (Materialien der Wissensbasis www.nanoobjects.info)
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2000
Ausbildung: Studium der Biologie in Marburg, Rostock, Pennsylvania und North Carolina
Informeller Lebenslauf:
Nach meiner Ausbildung zum BTA (Biol. Techn. Assitenten) an einem Fischereiinstitut in Nordrhein-Westfalen habe ich an verschiedenen Universitäten Biologie/Meeresbiologie mit Schwerpunkt Physiologie studiert. Für meine Doktorarbeit (über Diabetes bei Ratten) bin ich vom äußersten Nordosten (Rostock) in den Südwesten Deutschlands (Tübingen) gezogen und arbeite aber seit 2000 am UFZ. Hier habe ich in verschiedenen Projekten zu Themen wie Grundwassersanierung, Boden- und Sedimentökotoxikologie, Bioassay-Entwicklung und -Miniaturisierung, Alternativen zu Tierversuchen gearbeitet und so die meisten Bioassays des Departments BIOTOX kennengelernt. In letzter Zeit arbeite ich hauptsächlich an Themen, die auf die eine oder andere Weise das ökotoxikologische Monitoring und die Bewertung von Gewässerverunreinigungen und die Identifizierung der giftigsten Substanzen (einschließlich Pestizide oder Arzneimittel) als Teil eines Gemisches betreffen.
Forschungsinteressen:
- Mischungstoxizität, Toxikokinetik und Biotransformation von Pestiziden & Medikamenten
- Weiterentwicklung und Nutzung von Zebrabärblingsembryonen als Tierversuchsersatzalternative und zur Identifikation und Bewertung von Umweltkontaminationen
- Identifikation von spezifisch toxischen Pestiziden aus komplexen Mischungen wie z.B. Abwasser- oder Flusswasserproben
- Anpassung von Standardtests der Ökotoxikologie an die speziellen Bedingungen des Umweltmonitorings
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2015
Ausbildung: Student der Angewandten Naturwissenschaften in Freiberg
Informeller Lebenslauf:
David studierte Angewandte Naturwissenschaften mit den Schwerpunkten Umweltwissenschaften und Biotechnologie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Im Jahr 2015 erwarb David einen Master of Science für Studien zu toxikokinetischen und -dynamischen Aspekten von Anti-Acetylcholinesterase-Pestiziden auf molekularer und verhaltensbiologischer Ebene in larvalen Zebrafischen. Danach arbeitete David als wissenschaftlicher Mitarbeiter am UFZ Bioanalytical Ecotoxicology Department und führte toxikologische Studien an Zebrabärblingen durch. Im Jahr 2016 erhielt David ein Promotionsstipendium von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). In Anlehnung an die RWTH Aachen führte David seine Doktorarbeit zum Thema "Zebrafisch-Lokomotorik als empfindliches, wirkungsbasiertes Werkzeug zur Bewertung von Umweltchemikalien und -gemischen" am Department Bioanalytische Ökotoxikologie des UFZ durch. Nach seinem Abschluss kam David 2019 als Postdoc zur Tal-Gruppe, wo er derzeit eine Verhaltenstestbatterie für Zebrafische entwickelt, um die negativen Auswirkungen von Xenobiotika auf die Entwicklung der Kognition zu bewerten.
Forschungsinteressen:
- Verständnis der Toxizitätsmechanismen von Umweltchemikalien und -gemischen
- Entwicklung und Anwendung neuartiger verhaltensbasierter Assays im Larvenstadium des Zebrabärblings (Danio rerio) und modernster gentechnischer Ansätze, einschließlich CRISPR/Cas9-Gene Editing
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:
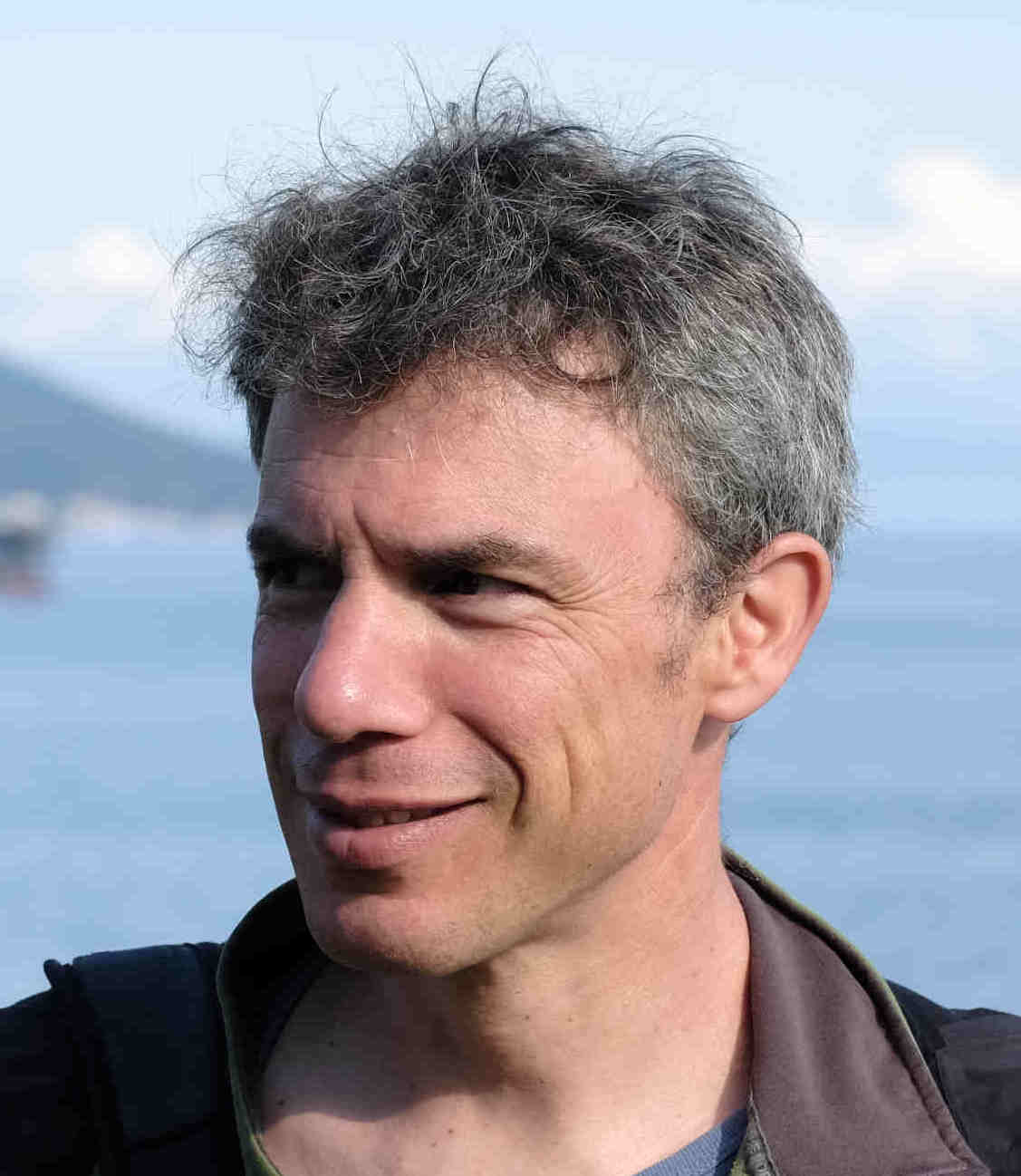
Beschäftigt am UFZ: seit 2006
Ausbildung: Studium der Biologie und Promotion in Tübingen
Informeller Lebenslauf:
Till Luckenbach studierte Biologie und promovierte an der Universität Tübingen. Er arbeitete danach bei Nicholas S. Foulkes am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen und war als Postdoc bei David Epel an der Hopkins Marine Station of Stanford University in Pacific Grove in Kalifornien, USA. Seit 2006 ist er am UFZ tätig und untersucht Anpassungsmechanismen von Wasserorganismen an Umweltstress, insbesondere von toxischen Chemikalien.
Forschungsinteressen:
- Molekulare aquatische Ökotoxikologie
- Anpassungen aquatischer Organismen an Umweltstress
- Zelluläre Mechanismen, die die Aufnahme und Abgabe von Chemikalien steuern
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2012
Ausbildung: Studium der Molekularen Biologie Perguia, Italien
Informeller Lebenslauf:
Ich habe Biologie und Molekularbiologie an der Universität von Perugia studiert. Dank eines Erasmus-Praktikumsstipendiums hatte ich 2012 die Möglichkeit, ein Praktikum am UFZ in der Abteilung für Bioanalytische Toxikologie zu absolvieren. Bei dieser Gelegenheit begann ich, mit dem Zebrafisch-Embryomodell zu arbeiten, und seitdem habe ich nie aufgehört, dieses alternative Tiermodell zu verwenden. Meine Doktorarbeit führte ich am UFZ (Department für Wirkungsorientierte Analytik) in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen (Institut für Umweltforschung) durch. Dabei verwendete ich Bioassays und chemische Analysen, um gefährliche Chemikalien in Sedimenten aus europäischen Flusseinzugsgebieten zu identifizieren. Danach trat ich meine erste Postdoc-Stelle am UFZ an, wo ich mich mit der Identifizierung neuroaktiver Chemikalien in Süßwasserumgebungen beschäftigte. Um mehr internationale Erfahrung zu sammeln, verbrachte ich ein Jahr in Belgien an der Universität Antwerpen (Zebrafishlab) und erforschte die subletalen Auswirkungen von narkotischen Chemikalien auf Zebrafischlarven. Seit 2021 bin ich zurück am UFZ im Department für Bioanalytische Toxikologie und arbeite als Wissenschaftlerin im europäischen Projekt PrecisionTox.
Forschungsinteressen:
- Anwendung des akuten Fischembryo-Toxizitätstests (FET) mit Zebrafischen in der Ökotoxikologie und Humantoxikologie. Insbesondere das Verständnis der Auswirkungen von Chemikalien auf den Phänotyp und das motorische Verhalten von Danio rerio-Embryonen
- Identifizierung schädlicher Schadstoffe in aquatischen Ökosystemen durch eine Kombination von Bioassays (d.h. FET mit Zebrabärblingen) und chemischer Analyse (Flüssig- und Gaschromatographie gekoppelt mit hochauflösender Massenspektroskopie).
- Entwicklung neuartiger Analyseverfahren zur Charakterisierung der toxischen Wirkung in verschiedenen Umweltmatrizes (z. B. Wasser und Sedimente). Priorisierung gefährlicher Chemikalien anhand von Wirkungsdaten aus Toxizitätsdatenbanken (z. B. EPA ECOTOX Database, Tox21)
- Anwendung multivariater statistischer Methoden zur Analyse komplexer toxikologischer/chemischer Daten und zur Verbesserung der Erforschung von Toxizitätsdatenbanken.
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2017
Ausbildung: Studium der Chemie und Biochemie in Leipzig
Informeller Lebenslauf:
Seit 2017 bin ich in der Abteilung Wissenschaftlich-administrative Projektbetreuung des UFZ für die Betreuung nationaler Drittmittel tätig. Zu meinen Aufgaben gehörten die Recherche von UFZ-spezifischen Ausschreibungen, die Betreuung von Anträgen für nationale Fördermittel sowie die Beratung (z.B. für Stipendien oder forschungsspezifische Ausschreibungen).
Seit Februar 2019 bin ich in der Abteilung Bioanalytische Ökotoxikologie als Postdoc für das (Nano)Wissenschaftskommunikationsprojekt DaNa4.0 zuständig. Meine Aufgaben konzentrieren sich auf die Umweltaspekte im Zusammenhang mit der Nanotechnologie und umfassen die Bewertung kürzlich veröffentlichter Ergebnisse im Bereich der Nanomaterialien. Darüber hinaus arbeite ich im Projekt NanoRigo an der Entwicklung einer Risikokommunikationsplattform für Nanomaterialien im Rahmen des Governance Framework.
Forschungsinteressen:
- Zusammenfassung von Veröffentlichungen zur Nanotechnologie in leicht verständlichen Übersichts- und Materialartikeln (veröffentlicht auf https://nanopartikel.info/)
- Entwicklung einer Plattform zur Risikokommunikation
Lebenslauf, Projekte und Auszeichnungen:
Beschäftigt am UFZ:
Ausbildung:
Informeller Lebenslauf:
Forschungsinteressen:
Lebenslauf, Publikationen und Forschungsstipendien:

Beschäftigt am UFZ: 1992-1995 und seit 2002
Ausbildung: Studium der Biologie in Bochum
Informeller Lebenslauf:
Nach meinem Biologiestudium mit Schwerpunkt Mikrobiologie habe ich die deutsche Wiedervereinigung zum Anlass genommen, den Standort und das Forschungsthema zu wechseln. Meine Doktorarbeit habe ich bereits am UFZ (in der damaligen Sektion Umweltchemie und Ökotoxikologie) durchgeführt und dabei primäre Hepatozyten als Hauptmodell für die Untersuchung von Chemikalienwirkungen verwendet. Danach lehrte und forschte ich mehr als sieben Jahre lang an der Universität Dresden (Zoologie), bis sich mir die Gelegenheit bot, zum UFZ zurückzukehren. Seit 2002 ist der Zebrafisch-Embryo mein Hauptversuchsmodell. Seit 2018 bin ich stellvertretender Leiter des Departments Bioanalytical Ecotoxicology.Forschungsinteressen:
- Verständnis der Mechanismen von Chemikalien und wie Mechanismen mit experimentellen Modellen (kleine Organismen) identifiziert werden können
- Verbesserung des Zebrafisch-Embryomodells durch die Entwicklung subletaler Endpunkte, die mit Schlüsselereignissen der schädlichen Wirkungen in Verbindung gebracht werden können
- Erhöhung der diagnostischen Kapazität, Automatisierung und Reproduzierbarkeit von Zebrafisch-Embryotests für die Bewertung chemischer Gefahren und Umweltproben
Lebenslauf, Publikationen und Auszeichnungen:

Beschäftigt am UFZ: seit 2019
Ausbildung: Studium der Toxikoligie in Chapel Hill, North Carolina, USA
Informeller Lebenslauf:
Prof. Dr. Tamara Tal leitet die Arbeitsgruppe Molekulare Toxikologie am Helmholtz-Zentrum für Gesundheitsforschung und Umwelt - UFZ. Seit 2021 hat sie zudem eine Professur für Integrierte Systemtoxikologie an der Universität Leipzig inne. Bevor sie 2019 ans UFZ kam, war Tamara Principal Investigator bei der United States Environmental Protection Agency (US EPA). Tamara absolvierte Postdoc-Stipendien in den Laboren von Dr. Robyn Tanguay (Oregon State University) und Dr. Stephanie Padilla (US EPA) und promovierte in Toxikologie an der University of North Carolina at Chapel Hill (Mentor: Dr. James Samet). Tamara hat 12 Jahre Erfahrung mit der Verwendung des Zebrafischmodells zur Entwicklung neuer Methoden, einschließlich der Bewertung toxikokinetischer und toxikodynamischer Wechselwirkungen zwischen Xenobiotika und dem Mikrobiom und der Verwendung von Gene-Editing zum Nachweis der Kausalität zwischen chemischer Exposition, molekularen Zielen und schädlichen Folgen.
Forschungsinteressen:
- Entwicklung neuer Methoden (NAMs) für die Entwicklungsneurotoxizität
- Verwendung molekularer Ansätze zur Klärung der Mechanismen, durch die eine chemische Exposition nachteilige Folgen hervorruft
- Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Chemikalien und Mikrobiom, die die Ergebnisse der Wirts-Toxizität beeinflussen
