Podcasts
Aktueller Podcast
Das Forschungsquartett von detektor.fm
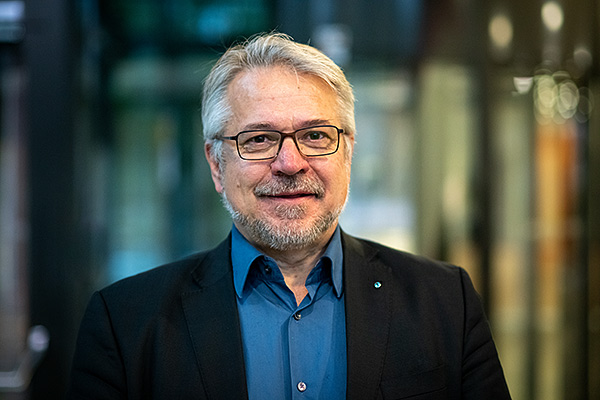
03.11.2023, Prof. Dr. Dietrich Borchardt, Leiter des UFZ-Themenbereichs Wasserressourcen und Umwelt | Dauer: 24:35 min
Der Wasserkreislauf ist gestört. Das hat die Weltwetterorganisation im Oktober erstmals bestätigt. Welche Folgen hat das für verschiedene Lebensbereiche – insbesondere für unsere Trinkwasserversorgung?
Podcast auf Detektor.fm anhören
Das Forschungsquartett von detektor.fm

09.11.2023, Dr. Andrea Kaim und Jun.-Prof. Dr. Bartosz Bartkowski / Leiter der Nachwuchsgruppe „AgriScape: Zielkonflikte auf dem Weg zu multifunktionalen Agrarlandschaften“ | Dauer: 20:11 min
Die Landwirtschaft muss nachhaltiger werden. Multifunktionalität soll helfen, sprich: mehr Vielfalt. Aber wie kommen wir dahin? Die Nachwuchsgruppe AgriScape will Zielkonflikte identifizieren und den Akteuren Lösungen an die Hand geben:
https://www.ufz.de/agriscape/
Das Forschungsquartett von detektor.fm

25.05.2023, Dr. Demetra Rakosy / UFZ-Themenbereich Ökosysteme der Zukunft/ AG Räumliche Interaktionsökologie | Dauer: 16:10 min
Rund 40 Prozent aller Insektenarten sind vom Aussterben bedroht, darunter viele Bestäuberinsekten. Wie lässt sich dieser Rückgang erklären und mit welchen Projekten können die Insekten besser geschützt werden? Zuerst braucht man Daten, die über Monitoringprojekte wie SPRING (www.ufz.de/spring-pollination) gesammelt werden.
Das Forschungsquartett von detektor.fm

16.03.2023, Prof. Dr. Wolfgang Köck / UFZ-Themenbereich Umwelt und Gesellschaft / Department Umwelt- und Planungsrecht | Dauer: 20:21 min
Das Bundeswaldgesetz regelt, wie der Wald aussehen, genutzt und bewirtschaftet werden soll. Eine Novellierung des Gesetzes ist durch neue Herausforderungen für den Wald dringend notwendig, das sieht auch die Ampel-Regierung so. Aber was muss rein in das neue Bundeswaldgesetz?
Wenn die Windkraft kommt
Das Forschungsquartettvon detektor.fm

20.01.2022, Junior-Prof. Dr. Paul Lehmann an der Universität Leipzig in Kooperation mit dem UFZ | Dauer: 12:38 min
Wenn Windräder an Land gebaut werden, hilft das dem klimafreundlichen Umbau der Energiewirtschaft. Es schafft aber auch Konflikte, die vor Ort gelöst werden müssen. Über die Herausforderungen für die neue Bundesregierung und Möglichkeiten, wie die Konflikte bei der Energiewende bewältigt werden können, spricht detektor.fm-Redakteur Lars Feyen mit Junior-Prof. Dr. Paul Lehmann.
Zwei Hörspiele zum Mariannenpark in Leipzig
Podcast zum Abschluss des Projektes KoopLab (Teilhabe durch kooperative Freiraumentwicklung - Ankunftsquartiere gemeinschaftlich entwickeln
Weitere Informationen zum Projekt: www.ufz.de/kooplab

2021 | #1: Geschichten aus und über den Mariannenpark | Dauer: 23:00 min
Der erste Teil informiert über die facettenreiche Geschichte des Parks seit seiner Entstehung. Zeitzeug:innen aus Schönefeld berichten von persönlichen Erlebnissen und interessanten historischen Ereignissen.
2021 | #2: Der Mariannenpark heute | Dauer: 27:00 min
Der zweite Teil geht auf aktuelle Herausforderungen der Parkentwicklung angesichts gesellschaftlicher und klimatischer Veränderungen ein. Es kommen Menschen zu Wort, die zum Mariannenpark forschen.
Die Themen der 26. UN-Klimakonferenz
Das Forschungsquartett von detektor.fm

28.10.2021, Prof. Dr. Reimund Schwarze / UFZ-Themenbereich Umwelt und Gesellschaft / Department Ökonomie | Dauer: 30:48 min
Vor der UN-Klimakonferenz COP26 herrscht Krisenstimmung: Überschwemmungen, Brände und ein dramatischer IPCC-Bericht sorgen für Handlungsdruck. Doch welche Hürden gibt es? Über Hintergründe und Fragen der UN-Klimakonferenz spricht Jonas Junack im Forschungsquartett mit Prof. Dr. Reimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Der Umweltökonom nimmt auch dieses Jahr wieder an der Konferenz teil.
Hat Corona das Ende des Städtewachstums eingeleitet?
Das Forschungsquartett von detektor.fm

29.07.2021, Prof. Dr. Dieter Rink / UFZ-Themenbereich Umwelt und Gesellschaft / Department Stadt- und Umweltsoziologie | Dauer: 11:25 min
Drei von vier Menschen auf der Welt leben in Städten – Tendenz steigend. Und auch in Deutschland wachsen Großstädte seit Jahrzehnten. Eine Studie des UFZ hat nun ergeben: Im letzten Jahr ist der Städteboom stark ausgebremst worden.
Mit Teebeuteln den Boden erforschen
Das Forschungsquartett von detektor.fm

29.04.2021, Dr. Susanne Döhler / UFZ-Themenbereich Ökosysteme der Zukunft / Department Bodensystemforschung | Dauer: 12:28
Mit bodenkundlichen Feldmethoden und dem „Tea Bag Index“ werden tausende Teilnehmende Daten über den Bodenzustand sammeln und der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Initiiert und begleitet wird die Kampagne von UFZ-Forscher*innen und dem BonaRes-Zentrums für Bodenforschung.
Blau-grüne Infrastruktur - Starkregen-Management in Städten
Das Forschungsquartett von detektor.fm

28.01.2021, Prof. Dr. Roland Müller / UFZ-Themenbereich Umwelt- und Biotechnologie / Department Umwelt- und Biotechnologisches Zentrum UFZ | Dauer: 16:22
Auch in Deutschland macht sich der Klimawandel bemerkbar: Immer öfter gibt es Starkregen und Dürreperioden. Das ist vor allem in Städten ein Problem. Wie kann dort effizient mit Regenwasser umgegangen werden?
Abwassermonitoring - Das Virus in der Kläranlage
Das Forschungsquartett von detektor.fm
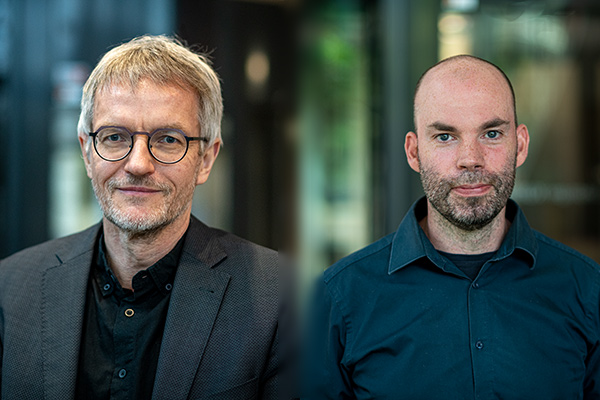
26.11. 2020, Prof. Dr. Hauke Harms und Dr. René Kallies / UFZ-Themenbereich Umwelt- und Biotechnologie / Department Umweltmikrobiologie | Dauer: 23:57 min
Seit diesem Frühling 2020 forscht eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an einer neuen Methode, das tatsächliche Corona-Infektionsgeschehen zu ermitteln. Sie folgen dem Virus in das Abwasser.
Lokale Wohnungspolitik - Wohnungsnot in deutschen Großstädten
Das Forschungsquartett von detektor.fm

10.09.2020, Prof. Dr. Dieter Rink / UFZ-Themenbereich Umwelt und Gesellschaft / Department Stadt- und Umweltsoziologie | Dauer: 16:22 min
In Deutschlands Städten fehlen bis zu 100 000 Wohnungen. Der Umgang mit der Wohnungsnot ist dabei von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Warum ist das so und wie gehen Städte mit der Not um?
Invasive Arten - Über den Gartenzaun
Das Forschungsquartett von detektor.fm
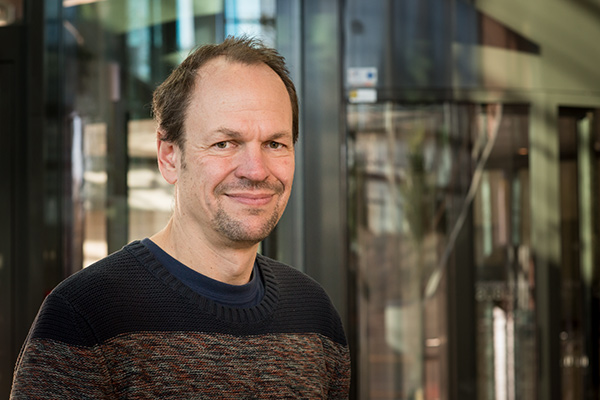
6.7.2020, Prof. Dr. Ingolf Kühn / UFZ-Themenbereich Ökosysteme der Zukunft / Department Biozönoseforschung | Dauer: 14:46 min
Eine neue Studie warnt vor den Schäden durch invasive Arten. Diese Tier- und Pflanzenarten gelangen auf verschiedenen Wegen in ein neues Gebiet und können dort gefährlich werden – auch für Menschen. Was muss geschehen, um diese Arten zu kontrollieren?
Biodiversität und Pandemien - Wie hängen Seuchen und Artenvielfalt zusammen?
Das Forschungsquartett von detektor.fm

09.04.2020 - Prof. Dr. Josef Settele / UFZ-Themenbereich Ökosysteme der Zukunft / Department Naturschutzforschung | Dauer: 11:07 min
Werden mit dem Verlust von Biodiversität globale Pandemien wahrscheinlicher? Über den Artenschutz als Prophylaxe gegen Virenübertragungen.
Bioökonomie - Nachhaltig Wirtschaften?
Das Forschungsquartett von detektor.fm

20.02.2020 - Prof. Dr. Daniela Thrän / Department Bioenergie | Dauer: 7:46 min
Agrarböden werden immer knapper, fossile Rohstoffe neigen sich dem Ende entgegen und müllen gleichzeitig unseren Planeten zu – vor allem in Form von Plastik. Die Bioökonomie will mit interdisziplinären Methoden diese Probleme angehen und Alternativen bieten.
Podcast-Archiv nach UFZ-Themenbereichen
Wie hängen Seuchen und Artenvielfalt zusammen?
Das Forschungsquartett von detektor.fm
09.04.2020 - Prof. Dr. Josef Settele / Department Naturschutzforschung | Dauer: 11:07 min
Boden muss besser geschützt werden - "Neben Klima und Wasser ist der Boden unterbelichtet"
Das Forschungsquartett von detektor.fm
05.12.2017 - Prof. Dr. Hans-jörg Vogel / Department Bodensystemforschung | Dauer: 8:33 min
Alles, was wir über Ökosysteme wissen. Und über Artenvielfalt.
Das Forschungsquartett von detektor.fm
10.01.2017 - Prof. Dr. Josef Settele / Department Biozönoseforschung | Dauer: 8:11 min
Geht da noch mehr? Landschaftsökologie: Die Grenzen des Wachstums
Das Forschungsquartett von detektor.fm
22.10.2015 - Prof. Dr. Ralf Seppelt / Department Landschaftsökologie | Dauer: 6:44 min
Regenwald-Abholzung: Klimafolgen sind größer als gedacht
Das Forschungsquartett von detektor.fm
23.10.2014 - Prof. Dr. Andreas Huth und Dr. Sandro Pütz / Department Ökologische Systemanalayse | Dauer: 4:21 min
Gespräch über den Weltbiodiversitätsrat (IPBES) und die Artenvielfalt mit Dr. Josef Settele und Dr. Carsten Neßhöver
Podcast von Holger Klein
März 2016 | Dauer: 1:34:04
Landnutzung, Biodiversität, Ökosystemleistungen und Erneuerbare Energien
Podcast von Holger Klein
November 2014 - Prof. Dr. Ralf Seppelt / Department Landschaftsökologie / Dauer: 45:30 min

Fast die Hälfte der Landfläche der Erde ist vom Menschen überprägt. Wesentliche Fragen sind deshalb, warum Menschen siedeln, wo sie siedeln und wie die Landnutzung auf eine solche Weise vorgenommen werden kann, dass Nachhaltigkeit und Artenvielflat gewährleistet bleiben, denn „wenn wir Biodiversität schützen wollen, dann muss das in den genutzten Naturräumen passieren“. Dazu wird im Topic zwar regional geforscht. Die Ergebnisse werden aber immer in einen globalen Kontext gebracht.
Integriertes Projekt
Neue Ökosysteme - Welchen Einfluss haben Klimawandel und Änderungen in der Landnutzung auf unsere Ökosysteme?
Podcast von Annegret Faber
Januar 2015 - Prof. Ingolf Kühn / Department Biozönoseforschung | Dauer: 6:53 min

Mit Ökosystemen ist es ein bisschen wie mit Autos: Wenn ein Auto in allen Einzelteilen vor Ihnen liegt, werden Sie es kaum schaffen, alles wieder richtig zusammenzusetzen – selbst dann nicht, wenn Sie eine gute Gebrauchsanleitung haben. Und selbst wenn sie alle Teile richtig zusammenbringen, wissen Sie noch lange nicht, was das Auto alles kann und wie die einzelnen Teile miteinander agieren. Ein falscher Reifen – und Ihr Auto fängt an zu schlingern. Noch schlimmer wird es beim falschen Treibstoff oder einem falschen elektronischen Bauteil. Und ähnlich funktioniert ein Ökosystem. Unendlich viele Elemente agieren miteinander. Im Projekt „Neue Ökosysteme“ wollen Wissenschaftler des UFZ zumindest einen Teil dieser Zusammenhänge entschlüsseln, um zu erfahren, wie sie sich unter verändertem Klima entwickeln werden. Weil das Funktionieren der Ökosysteme die Grundlage für unser Leben ist. Frisches Wasser, saubere Luft, Bereitstellung von Biomasse, Nahrungsmitteln, Bestäubung von Pflanzen. Wie Sie das machen, hören Sie im Podcast.
Integriertes Projekt
Landnutzungskonflikte - Wie hängen Bienen von unseren Landschaften ab und was leisten sie für unsere Landwirtschaft?
Podcast von Annegret Faber
November 2014 - Dr. Oliver Schweiger und Dr. Stefan Klotz / Department Biozönoseforschung / Dauer: 8:45 min

Der Zoologe Oliver Schweiger hat bei diesem Projekt jede Menge Rechenaufgaben. Unzählige Daten fügt er in ein Rechenmodell ein. Dieses umfasst Parameter der Artenvielfalt, Ackerflächen, Pestizidmengen, bebaute Gebiete. Kurzum: unsere Landschaften und damit unsere Umwelt. Aus den Ergebnissen des mathematischen Modells resultieren Rückschlüsse für Handlungsstrategien. Zum Beispiel: Wenn eine Ackerfläche am Leipziger Stadtrand noch größer wird, würde die Zahl der Wildbienen um 20% zurückgehen. Daraus ergibt sich eine geringere Erntemenge in der benachbarten Apfelplantage. Gesamtwirtschaftlich gesehen ist es also nicht empfehlenswert, den Acker zu vergrößern.
Holger Klein im Gespräch mit PD Dr. Josef Settele zum IPCC-Klimabericht
März 2014 | Dauer: 45:27
Biodiversität und Gesundheit
November 2010 - Dr. Hans-Hermann Thulke / Department Ökosystemanalyse | Dauer: 6:51 min
Biodiversität und Energie
Oktober 2010 - Prof. Dr. Daniela Thrän / Department Bioenergie | Dauer: 5:26 min
Biodiversität und Wasser
September 2010 - Prof. Dr. Dietrich Borchardt / Department Aquatische Ökosystemanalyse | Dauer: 7:18 min
Biodiversität und Landwirtschaft
August 2010 - Prof. Dr. Josef Settele / Department Biozönoseforschung | Dauer: 6:02 min
Biodiversität und Ökonomie
Juni 2010 - Prof. Dr. Bernd Hansjürgens / Department Umweltökonomie | Dauer: 6:06 min
Biodiversität und Ethik
Mai 2010 - Prof. Dr. Kurt Jax / Department Naturschutzforschung | Dauer: 6:02 min
Biodiversität und Politik
April 2010 - Prof. Dr. Christoph Görg / Department Umweltpolitik | Dauer: 6:11 min
Biodiversität und Verkehr
Februar 2010 - Prof. Dr. Klaus Henle / Department Naturschutzforschung & Prof. Dr. Ingolf Kühn / Department Biozönoseforschung| Dauer: 7:16 min
Wasser für die Zukunft – Wassermanagement in der Mongolei
Das Forschungsquartett von detektor.fm
15.01.2019 - Prof. Dr. Dietrich Borchardt / Department Aquatische Systemanalyse | Dauer: 6:48 min
Bessere Überwachung unseres Trinkwassers
Das Forschungsquartett von detektor.fm
29.11.2016 - Dr. Daniel Karthe / Department Aquatische Ökosystemanalyse | Dauer: 6:50 min
Kann man das trinken? Die Qualität des Wassers – auf dem Weg zu einem World Water Quality Assessment
Das Forschungsquartett von detektor.fm
17.03.2016 - Prof. Dr. Dietrich Borchardt / Department Aquatische Ökosystemanalyse | Dauer: 6:53 min
Wie viel Leben spendet das Tote Meer? Totes Meer – Wasserforschung
Das Forschungsquartett von detektor.fm
12.02.2015 - Dr. Christian Siebert, Dr. Stefan Geyer, Prof. Dr. Ralf Merz / Department Catchment Hydrology | Dauer: 7:42 min
Gespräch mit Prof. Dr. Dietrich Borchardt zum UFZ-Kernthema "Nachhaltiges Management von Wasserressourcen"
Podcast von Holger Klein
November 2014 / Dauer: 51:06 min

Wasser ist unentbehrlich – und der Zugang zu sauberem Wasser ist Menschenrecht. Um zu helfen, dieses Recht umzusetzen, werden am UFZ Methoden entwickelt, mit denen Stoffbilanzen für Gewässer erstellt und Transformationsprozesse von Chemikalien nachvollzogen werden können. Es werden Modelle entwickelt, mit denen es möglich ist zu erklären, wie und warum bestimmte Stoffkonzentrationen überhaupt zustande gekommen sind und daraus abzuleiten, auf welche Weise der Mensch Wasser- und Stoffkreisläufe in Zeiten von Klimawandel und Globalisierung in wasserarmen und wasserreichen Regionen dieser Welt managen kann.
Integriertes Projekt
Stoffdynamik in Einzugsgebieten - Was wird in 500 Jahren sein?
Podcast von Annegret Faber
November 2014 - Prof. Dr. Jan Fleckenstein / Department Hydrologie & Dr. Karsten Rinke / Department Seenforschung / Dauer: 8:45 min

Das wissen wir nicht. Doch sicher ist eins. Auch dann brauchen wir noch sauberes Trinkwasser. Wer glaubt, das wäre vor allem ein Problem in Entwicklungsländern oder wasserarmen Regionen der Welt, der liegt falsch. Auch in Industrienationen wie Deutschland ist das eine große Herausforderung. Wir wissen heute noch nicht, wie sich Landwirtschaft, Verkehr und Industrie in Zukunft auf unsere wertvollen Grund- und Oberflächenwasserressourcen auswirken werden. Wasser und Stoffströme verlaufen zum Teil im Untergrund und die genauen Fließpfade sind daher oft schwer zu erfassen. Diese nachzuvollziehen und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten, ist eine große wissenschaftliche Herausforderung. Hinzu kommen Phänomene, die vor ein paar Jahren noch unbekannt waren. Zum Beispiel zu viele Huminstoffe im Wasser von Talsperren. Seit 20 Jahren steigt die Menge kontinuierlich an. Ein weltweites Problem. Die Ursachen sind noch nicht abschließend geklärt. Wenn dieser Trend so weiter geht, könnte unser Trinkwasser gefährdet sein.
Integriertes Projekt
Aquatische Ökosysteme - Lebensader Fluss
Podcast von Annegret Faber
Januar 2015 - Prof. Dr. Markus Weitere / Department Fließgewässerökologie | Dauer: 8:15 min

Integriertes Projekt
Wasserknappheit - Die Nutzung einer begrenzten Ressource
Podcast von Annegret Faber
März 2015 / Dauer: 6:07 min

Wasser und Altlasten
Januar 2012 - Prof. Dr. Frank-Dieter Kopinke / Department Technische Umweltchemie | Dauer: 6:54 min
Wasser und der Fluss der Stoffe
Juni 2011 - Prof. Dr. Jan Fleckenstein / Department Hydrologie | Dauer: 6:36 min
Interview: Water Science Alliance - Wasserforschung vernetzen
Juni 2011 - Prof. Dr. Georg Teutsch / Wissenschaftlicher Geschäftsführer des UFZ | Dauer: 5:01 min
Interview: Water Research Horizon Conference - Eine Plattform für die Wasserforschung
Juni 2011 - Prof. Dr. Georg Teutsch / Wissenschaftlicher Geschäftsführer des UFZ | 8:26 min
Wasser und Monitoring
Mai 2011 - Dr. Steffen Zacharias / Department Monitoring und Erkundungstechnologien | Dauer: 6:02 min
Wasser und Städte
April 2011 - Prof. Dr. Peter Krebs / Technische Universität Dresden | Dauer 7:25 min
Wasser und Globaler Wandel
März 2011 - Prof. Dr. Dietrich Borchardt / Department Aquatische Ökosystemanalyse | Dauer: 6:50 min
Biodiversität und Wasser
September 2010 - Prof. Dr. Dietrich Borchardt / Department Aquatische Ökosystemanalyse | Dauer: 7:18 min
Ursachen von Zivilisationskrankheiten - Spurensuche in der Kinderheit
Das Forschungsquartett von detektor.fm
15.08.2019 - Dr. Gunda Herberth / Department Umweltimmunologie | Dauer: 6:57 min
Gespräch mit PD Dr. Rolf Altenburger zum UFZ-Kernthema "Chemikalien in der Umwelt und Gesundheit"
Podcast von Holger Klein
November 2014 / Dauer: 45:53 min

Wir verwenden Chemikalien in großen Mengen in Produkten, die unser Leben verbessern. Gelangen sie bewusst oder unbewusst in die Umwelt, vermögen es Mensch und Natur nur begrenzt, ihre Wirkungen auf die Umwelt auszugleichen. Deshalb untersuchen die UFZ-Wissenschaftler Stoffeigenschaften und Umweltverhalten von Chemikalien. Welche Stoffe werden nicht abgebaut (Persistenz)? Welche reichern sich in Organismen an (Bioakkumulation)? Und welche sind giftig (Toxizität)? Dazu werden nicht nur chemische, sondern auch biologische Analysemethoden angewandt und weiterentwickelt mit dem Ziel, von der Reaktion einzelner Zellen, Organismen oder Lebensgemeinschaften auf ganze Ökosysteme oder den Menschen schließen zu können.
Integriertes Projekt
Umweltverhalten von Chemikalien
Podcast von Annegret Faber
Juni 2015 - Dr. Lukas Wick / Department Umweltmikrobiologie | Dauer: 7:54 min

Arsen, Antimon und Co
August 2012 - Dr. Birgit Daus / Department Grundwassersanierung | Dauer: 5:01 min
Chemikalien in der Umwelt
April 2012 - Interview mit Prof. Dr. Rolf Altenburger / Department Bioanalytische Ökotoxikologie | Dauer: 6:08 min
Strom erzeugen, statt verbrauchen - Elektroaktive Bakterien
Das Forschungsquartett von detektor.fm
08.05.2018 - Prof. Dr. Falk Harnisch / Department Umweltmikrobiologie | Dauer: 6:22 min
Saubere Energie aus Bakterien - Bakterien erzeugen Wasserstoff
Das Forschungsquartett von detektor.fm
21.01.2016 - Prof. Dr. Andreas Schmid / Department Solare Materialien | Dauer: 5:51 min
Die nützliche Pest - Projekt AquaMak zur Wasserpest
Das Forschungsquartett von detektor.fm
16.07.2015 - Prof. Dr. Andreas Zehnsdorf / Department Umwelt- und Biotechnologisches Zentrum (UBZ) | Dauer: 7:06 min
Mikroorganismen neu erforscht. Mikrobielle WGs - die kleinen Städte der Natur
Das Forschungsquartett von detektor.fm
07.05.2015 - PD Dr. Hans-Hermann Richnow / Department Isotopenbiogeochemie | Dauer: 5:43 min
Bakterien und Pilzautobahnen
Juli 2012 - Dr. Lukas Wick und Dr. Thomas Banitz / Department Umweltmikrobiologie | Dauer: 5:19 min
Zeitalter der Dürre - Modellierung von extremen Wettereignissen
Das Forschungsquartett von detektor.fm
23.10.2018 - Dr. Andreas Marx / Department Hydrosystemmodellierung | Dauer: 9:55 min
Alle reden übers Wetter. Klimaänderungen in Mitteldeutschland
Das Forschungsquartett von detektor.fm
12.09.2017 - Dr. Andreas Marx / Department Hydrosystemmodellierung | Dauer: 9:00 min
Terrestrische Systeme: Von der Beobachtung zur Vorhersage
Podcast von Holger Klein
März 2015 - Prof. Dr. Sabine Attinger / Department Hydrosystemmodellierung | Dauer: 42:07 min

Wissenschaftler in dem Querschnittsthema (Topic 5 "Terrestrische Systeme: Von der Beobachtung zur Vorhersage") entwickeln Modelle, um Vorhersagen zu machen. Die Basis ihrer Modelle sind Messungen und Bobachtungen und die Anwendungsbereiche der Modelle liegen in der Hydrologie und Ökologie. Darüber hinaus unterscheiden sich die Modelle in ihrer Skala: Diese reicht von wenigen Quadratmetern bis hin zu Flussgebiete mit mehreren tausend Quadratkilometern. Am Beispiel eines Hochwassermodells erläutert Sabine Attinger die Komplexität der Entwicklung: In ein solches Modell fließen Angaben zur Vegetationsbedeckung, Bodenkarten mit den jeweiligen Bodentypen sowie Grundwasserparameter.
Integriertes Projekt
"Vom Modell zur Vohersage - Die Zukunftswerkstatt
Podcast von Annegret Faber
Januar 2015 - Prof. Dr. Andreas Huth / Department Ökologische Systemanalyse & Prof. Dr. Sabine Attinger / Department Hydrosystemmodellierung | Dauer: 7:03 min

Bioökonomie - Nachhaltig Wirtschaften?
Das Forschungsquartett von detektor.fm
20.02.2020 - Prof. Dr. Daniela Thrän / Department Bioenergie | Dauer: 7:46 min
Wie berechnet man frische Luft?
Das Forschungsquartett von detektor.fm
28.11.2017 - Prof. Dr. Bernd Hansjürgens / Department Ökonomie | 5:25 min
Keine Ahnung, kein Problem! Nichtwissen in der Wissenschaft
Das Forschungsquartett von detektor.fm
29.08.2017 - Prof. Dr. Matthias Groß / Department Stadt- und Umweltsoziologie | Dauer: 6:10 min
Integriertes Projekt "Urbane Transformationen":
Die Stadt – Chance und Herausforderung
Podcast von Annegret Faber
November 2014 - Prof. Dr. Sigrun Kabisch / Department Stadt- und Umweltsoziologie | Dauer: 7:28 min

Lebten um 1900 noch 13 Prozent aller Menschen in Städten, ist es heute über die Hälfte der Weltbevölkerung – 54 Prozent. Städte sind Dreh- und Angelpunkte unserer gesellschaftlichen Entwicklung: Sie wachsen, schrumpfen, altern, werden schneller und mobiler, lauter oder leiser, dichter oder leerer, grauer oder grüner, anfälliger oder robuster. Sie brauchen und verbrauchen wertvolle Ressourcen: Raum, Fläche, Energie, Wasser. Sie stoßen CO2 aus. Hinzu kommt der Klimawandel. Städte sind Extremereignissen wie Hochwasser oder Hitzewellen ausgesetzt. Planer müssen sich deshalb ständig neuen Herausforderungen stellen. Wie gehen wir damit verantwortungsvoll um? Wie können Entwicklungen gesteuert, Konflikte gelöst und Chancen genutzt werden, damit das Leben in Städten auch in Zukunft lebenswert ist?
Integriertes Projekt "Raumwirksamkeit der Energiewende":
Wie und wo soll die Energie der Zukunft produziert werden?
Podcast von Annegret Faber
Januar 2014 - Prof. Dr. Karin Frank / Department Ökologische Systemanalyse & Prof. Dr. Daniela Thrän / Department Bioenergie | Dauer: 7:27 min

Deutschland hat eine Fläche von 357 111 Quadratkilometer. Das ist die Hälfte von Texas oder von der Türkei. Auf dieser relativ kleinen Fläche haben sich die Deutschen etwas sehr Mutiges vorgenommen. Sie wollen auf Kohle und Atomkraft soweit es geht verzichten und Energie gewinnen, die erneuerbar und umweltverträglich ist und weniger klimaschädliches Kohlendioxid produziert. Alle sind damit einverstanden. Die Deutschen stehen hinter diesem Vorhaben. Es gibt aber ein großes Problem: die begrenzte Fläche. Das Windrad steht viel zu nah am Haus, die Stromtrasse viel zu nah am Ort und die stinkende Biogasanlage belästigt die Anwohner. Nur wenige Themen erhitzen die Gemüter so stark, wie die Energiewende. Im Integrierten Projekt 'Energie und Landnutzung' wollen die Helmholtz-Forscher einen Weg finden, der für alle Parteien Vorteile bringt. Dem Menschen ebenso wie der Umwelt. Erste Erkenntnisse gibt es bereits.
Holger Klein im Gespräch mit Christian Kuhlicke zum Hochwasser
Juni 2013 | Dauer: 35:54
