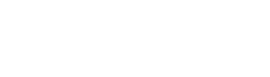Grundlagen des Umweltrechts
Dynamiken des Ausgleichs – Eine Untersuchung gesetzgeberischer Instrumente der Kollisionslösung im mehrpoligen Verfassungsrechtsverhältnis des Umweltrechts zwischen den Zulassungsregimen für konventionelle und erneuerbare Energieerzeugung
Niklas Täuber - Freie Universität Berlin, Prof. C. Calliess
Um die im Pariser-Klimaabkommen vereinbarten Ziele zur Bekämpfung der Klimakrise zu erreichen und so die Möglichkeit zu erhalten, katastrophale Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern oder zumindest abzumildern, muss jeder der Vertragsstaaten, so auch Deutschland, seinen Ausstoß an Treibhausgasen signifikant vermindern. Zur Erreichung der ausgesetzten Ziele ist der Ausbau von erneuerbaren Energien und der zugehörigen Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Dieser stockt jedoch seit Jahren. Die Realisierung eines einzelnen Windrades dauert von Idee bis zur ersten Stromerzeugung oft fünf bis sieben Jahre. Aus diesem Grund hat die neu formierte Ampel-Koalition im Nachgang der Bundestagswahl 2021 eine Reihe an Gesetzesnovellen mit Beschleunigungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, um die langwierigen Verfahren zur Projektrealisierung zu beschleunigen; politisch ist für die Energiewende nun ein „Deutschlandtempo“ ausgerufen. Die hier auf Weg gebrachten Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Effizienz und Rechtmäßigkeit in der juristischen Literatur vielfach untersucht worden.
Eine grundlegende verfassungsrechtliche Betrachtung fehlt hingegen. Diese Lücke möchte das Dissertationsprojekt schließen. Dabei soll untersucht werden, inwieweit das Grundgesetz ein solches „Deutschlandtempo“ vorgibt oder durch gegenläufige Interessen – wie vor allem dem Umwelt- und Artenschutz – ausbremst. Kern der Analyse ist die Erarbeitung des sich spezifisch für den Ausbau der Erneuerbaren-Energie-Infrastruktur ergebenden mehrpoligen Verfassungsverhältnisses. Während sich das klassische Umweltrecht zumeist in ein klassisches Verfassungsrechts“dreieck“ (Begünstigter – Belasteter – Umwelt) fügt, ergibt sich hier eine komplexere Grundsituation. Dabei soll insbesondere die Aufspaltung des Umweltstaatsziels aus Art. 20a GG aufgearbeitet werden, welches als klimaschützende Norm einerseits zum beschleunigten Ausbau auffordert, andererseits auch im klassischen Sinne Umwelt- und Artenschutz einfordert und so den Ausbau gleichzeitig zu bremsen vermag. Ergänzt wird dies durch weitere verfassungsrechtliche relevante Belange, wobei insbesondere die verfassungsgerichtliche Neuschöpfung der intertemporalen Freiheitssicherung einzuordnen ist. Im weiteren Rahmen der Arbeit soll so anwendend untersucht werden, inwieweit dieses Verfassungsverhältnis die gesetzgeberischen Verfahrensbeschleunigungsversuche durch die Setzung von Ober- und Untergrenzen aber auch darüber hinaus zu steuern vermag.
Der Compliance Mechanismus der Aarhus-Konvention – ein wirksamer Schutz der Umweltbeteiligungsrechte?
Kristina Dierkes - Universität Osnabrück, Prof. P. Cancik
Die Aarhus-Konvention ist der erste völkerrechtliche Vertrag, der verbindlich Umweltverfahrensrechte zuerkennt. Angesichts großer Vollzugsdefizite in den nationalen Umweltrechtsordnungen gibt sie natürlichen Personen und anerkannten Umweltverbänden wichtige Instrumente an die Hand, um auf die Einhaltung materiellen Umweltrechts hinzuwirken. In der Konvention sind folgende Rechte verankert: das Recht auf Zugang zu Umweltinformationen, das Recht auf Öffentlichkeitsbeteiligung und das Recht auf Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten.
Sofern die ‚Aarhus-Rechte‘ auf nationaler Ebene nicht gewährleistet werden, können die verstoßende Vertragspartei oder eine andere Vertragspartei, das Sekretariat oder die Öffentlichkeit der Vertragsparteien den Compliance Mechanismus der Aarhus-Konvention in Gang setzen. Das Aarhus Convention Compliance Committee (ACCC) prüft, ob ein Rechtsverstoß der betreffenden Vertragspartei vorliegt. Sofern das es einen Verstoß feststellt, entscheidet die Tagung der Vertragsparteien unter Berücksichtigung der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen des ACCC über die zu ergreifenden Maßnahmen. In einem anschließenden Follow-Up Verfahren unterstützt das ACCC die Vertragsparteien bei der Umsetzung dieser Maßnahmen.
Das Promotionsprojekt erforscht die Effektivität des Compliance Mechanismus der Aarhus Konvention. Dabei wird das Umsetzungsverhalten der Vertragsparteien im Rahmen des Follow-Up Verfahrens unter Berücksichtigung struktureller und prozeduraler Aspekte des Mechanismus systematisch analysiert. Ziel ist es, Faktoren, die den Umsetzungsprozess beeinflussen, Trends im Umsetzungsverhalten der Vertragsparteien, Herausforderungen einer zeitnahen Umsetzung und mögliche Lösungsansätze zur Überwindung dieser Herausforderungen zu ermitteln.
Naturschutz als Kompensationsinstrument - eine vergleichende Untersuchung ausgewählter Kompensationssysteme
Jan Markgraf - Universität Osnabrück, Prof. P. Cancik
Das Naturschutzrecht sieht seit Langem die Kompensation von Eingriffen vor. Kompensationsmaßnahmen sollen die negativen Umweltfolgen der Eingriffe ausgleichen oder zumindest reduzieren. Aber auch in anderen Bereichen soll Naturschutz als Kompensationsinstrument dienen, z.B. im Klimaschutzrecht als Ausgleich für CO2-Emissionen. Trotz rechtlicher Vorgaben und praktizierter Kompensationen wird das ökologische Gleichgewicht weiterhin erheblich beeinträchtigt. Mit der Summation von Eingriffen nehmen Artensterben und Klimakatastrophen weiter zu. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Praxis und Konzept der Kompensation die Ziele ausreichend erreichen können.
In meinem Promotionsvorhaben wird zunächst untersucht, welche Beeinträchtigungen überhaupt durch Mittel des Naturschutzes neutralisiert werden können und wo die Grenzen dieser Kompensationen liegen. Darauf aufbauend werden zum einen die Systeme zur „obligatorischen Kompensation“ untersucht und bestehende Defizite herausgearbeitet. Zum anderen werden die Systeme zur „freiwilligen Kompensation“ analysiert. Insbesondere im Bereich des Klimaschutzes sind solche freiwilligen Kompensationssysteme zu finden, bei denen für naturschützende Maßnahmen sog. kompensatorische Zertifikate ausgestellt werden. Sie sollen eine „neutrale Ökobilanz“ ermöglichen, um Dienstleistungen oder Waren als „umweltfreundlich“ kennzeichnen zu können. Mit derartigen freiwilligen Kompensationsmechanismen sind derzeit hohe Erwartungen der Verbesserung des Natur- und Klimaschutzes verbunden. Das damit einhergehende Versprechen der Kompensierbarkeit, also der wirkliche Ausgleich von umweltschädlichen Verhalten, soll hinterfragt werden.
Das Promotionsvorhaben soll dafür sowohl die unzureichende Umsetzung als auch die Unzulänglichkeit bestehender Kompensationssysteme darlegen. In einem weiteren Schritt sollen Verbesserungen des Kompensationsansatzes analysiert werden. So ist hinsichtlich der Wirksamkeit der Kompensation die Frage zu klären, ob naturschützende Maßnahmen als Mittel der Kompensation unterschiedlicher Arten von Umwelteingriffen gebündelt und räumlich vernetzt im Rahmen von Flächen- und Maßnahmenpools umgesetzt werden können. Dadurch könnte ein übergeordnetes Kompensationssystem zum Zweck eines Synergieeffekts etabliert und eine ökologisch sinnvolle Flächenorganisation samt multifunktionaler Flächennutzung herbeigeführt werden. Gerade dadurch könnte zum Erhalt der Biodiversität und des ökologischen Gleichgewichts beigetragen werden.
Politikplanungsrecht als Instrument der Nachhaltigkeitstransformation – Eine Referenzgebietsanalyse anhand der rechtsförmigen Planung der Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Biodiversitätsschutzpolitik
Marvin Neubauer - UFZ, Dr. Moritz Reese
Die Nachhaltigkeitstransformation ist eine komplexe Angelegenheit. Viele staatliche und nichtstaatliche Akteure sind beteiligt, der Prozess streckt sich über einen langen Zeitraum und steht in ständiger Wechselbeziehung mit anderen Mega-Trends (wie etwa der Digitalisierung oder den Machtverschiebungen auf internationaler Ebene) sowie akuten politischen oder wirtschaftlichen Krisen (etwa einer Gasmangellage). Will die Politik die Nachhaltigkeitstransformation vorantreiben, so braucht sie einen übergreifenden Plan davon, wie sie in dieser Gemengelage und über einen Zeitraum von 10, 20 oder 30 Jahren konsistent agieren will. Dasjenige Recht, das solche politischen Pläne und Strategien hervorbringt und ihren Vollzug regelt, bezeichnet man als Politikplanungsrecht. Prominentestes Beispiel eines Politikplanungsgesetzes ist das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), mit seinen Treibhausgas-Reduktionspfaden, seinen Klimaschutz- und Sofortprogrammen, seinem für das Monitoring der Planung zuständigen Expertenrat und seinem Berücksichtigungsgebot. Mit dem Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) findet sich aber auch ein Politikplanungsgesetz im Bereich der Klimaanpassung, dem bald auch Klimaanpassungsgesetze und -strategien auf Landesebene folgen werden. Das Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) und die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur zeugen schließlich von politikplanungsrechtlichen Bestrebungen auch im Biodiversitätsschutz. Das Promotionsvorhaben nimmt diese Entwicklungen in den Bereichen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und des Biodiversitätsschutzes zum Anlass, um sich einmal grundlegend mit dem Instrument des Politikplanungsrechts auseinanderzusetzen. Was sind seine obligatorischen, was fakultative Merkmale? Welche spezifischen Funktionen erfüllt dieses Instrument für die Nachhaltigkeitstransformation? Mithilfe welcher Mechaniken bringt es seine Steuerungseffekte hervor? Und welche Zielkonflikte und Rechtsfragen stellen sich bei deren Ausgestaltung? Ausgehend von den Referenzgebieten der Politikplanungsgesetze zum Klimaschutz, zur Klimaanpassung und zum Biodiversitätsschutz sowie der zugehörigen Rechtsprechung und Dogmatik sollen zum einen grundlegende Strukturen und Probleme der rechtsförmigen Politikplanung steuerungswissenschaftlich erörtert werden. Zum anderen sollen übergreifende Rechtsfragen des Politikplanungsrechts identifiziert und diskutiert werden, um so einen Beitrag zu einer allgemeinen politikplanungsrechtlichen Dogmatik zu leisten.