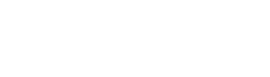Klimaschutz und -anpassung
Der Budgetansatz im Klimaschutzrecht - Das Bewirtschaftungskonzept der Transformation
Frerk Meiners - Universität Bremen, Prof. C. Franzius
Die Veränderungen der klimatischen Bedingungen durch den anthropogenen Klimawandel stellen eine der zentralen Herausforderungen dieses Jahrhunderts dar. Vor diesem Kontext hat sich auf der politischen Ebene langfristig die Erkenntnis durchgesetzt, dass gem. Art. 2 S. 1 KRK eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zu erreichen ist, auf der eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird. Das Klimaschutzrecht hat auf diesen Umstand reagiert und in einem langwierigen Prozess die notwendigen Strukturen im Mehrebenensystem aufgebaut. In diesem Prozess gewinnt der Gedanke zunehmend an Gewicht die normativen Treibhausgasbudgets, als Instrumente des Klimaschutzrechts einzusetzen. Zugleich setzt sich die Erkenntnis durch, dass die bloße Reduktion der Treibhausgase nicht ausreicht, sondern es einer ganzheitlichen Transformation in eine klimaneutrale Lebensweise bedarf.
Die Arbeit geht vor diesem Hintergrund von der Prämisse aus, dass der Budgetansatz im Klimaschutzrecht das Bewirtschaftungskonzept der Transformation ist und ihm eine Schlüsselrolle zukommt. Damit dieser Gedanke herausgearbeitet werden kann, wird in einem ersten Teil der Arbeit, die Entwicklung von normativen Treibhausgasbudgets nachgezeichnet, die den Grundstein für einen bewirtschaftungsrechtlichen Ansatz markieren. Diesen geschaffenen Transformationsansätzen wird jedoch der Einwand entgegengehalten, dass ihr Ambitionsniveau nicht ausreicht, um die Ziele aus dem Pariser Abkommen einzuhalten. Aufgegriffen wird diese Tatsache nicht zuletzt im Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Der zweite Teil dieser Arbeit widmet sich einer Analyse der rechtlichen Anforderungen, denen die normativen Treibhausgasbudgets ausgesetzt sind.
Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, welche normativen Eigenschaften das Bewirtschaftungskonzept der Transformationen im Hinblick auf die normativen Treibhausgasbudgets kennzeichnet.
Ziel dieser Arbeit ist es – de lege lata – die rechtlichen Grundlagen und Anforderungen für das Bewirtschaftungskonzept der Transformation unter besonderer Würdigung der normativen Treibhausgasbudgets herauszustellen.
Klimawandelanpassungsrecht im Bundesstaat
Tim Heidler - Universität Greifswald, Prof. S. Schlacke
Zunehmendes Artensterben, häufigere Extremwetterereignisse, rückgehender Grundwasserspiegel etc.: Die Folgen der klimatischen Veränderung sind bereits in der Gegenwart zu spüren. Außerdem ist es klimawissenschaftliche Prognose, dass die Folgen in ihrer Dauer, Häufigkeit sowie Intensität zukünftig zunehmen werden. Selbst bei Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels oder 2-Grad-Ziels werden spürbare Veränderungen eintreten. Deshalb können allein klimaschützende Maßnahmen die Veränderungen und Folgen nicht gänzlich abwenden. Folglich besteht eine gesellschaftliche Aufgabe darin, sich auf die neuen Lebensbedingungen auszurichten und etwa vorbereitende Schutzmaßnahmen zu treffen. Beispielhalber sind der Ausbau der Hochwasserschutzanlagen oder die Schaffung von Freiluftschneisen zu nennen.
An dieser Stelle setzt der Sachbereich Klimawandelanpassung an, der im Fokus der Untersuchung steht. Ein rechtliches Problem besteht jedoch darin, dass dieser Sachbereich erst vereinzelt Normierung erfahren hat. Indes sind in jüngerer Zeit neue Regelungen – insbesondere in der Bundesrepublik auf allen Ebenen des Rechts – zu verzeichnen. Sie werfen diverse Rechtsfragen auf.
Im Schwerpunkt widmet die Arbeit sich den Gesetzen des Bundes und der Länder. Sie werden unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert, bewertet und rechtlich überprüft. Daneben eruiert die Untersuchung grundlegende Fragestellungen der Klimawandelanpassung. Schließlich komplettiert die Erarbeitung von Optimierungsansätzen das Vorhaben.
Die normative Steuerung von Schutzgüterabwägungen zur Beschleunigung von Klimaschutzvorhaben
Julius Pfeuffer - Universität Leipzig, Prof. K. Faßbender
Fläche ist eine begrenzte Ressource. Jedes Stück Land auf der Erde steht im Prinzip nur für eine Nutzung zur Verfügung. Mit jeder Entscheidung für oder gegen einen Flächennutzungswandel drehen wir an Stellschrauben, die ungeahnte Veränderungen, aber auch neue Entwicklungspotenziale nach sich ziehen können. Um einzelfallgerechte Nutzungsverhältnisse herzustellen, delegieren die Gesetzgeber häufig Wertungsspielräume an Behörden und Gerichte. Der Arbeit liegt jedoch die Hypothese zugrunde, dass diese Art der Entscheidungsfindung gerade im Bereich der Energiewende als zu zeitaufwändig empfunden wird, um die europäische Nachhaltigkeitstransformation im Angesicht der „Poly-Krise“ adäquat voranzutreiben.
Deshalb untersucht das Forschungsvorhaben „Die normative Steuerung von Schutzgüterabwägungen zur Beschleunigung von Klimaschutzvorhaben“, wie der Gesetzgeber die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung stärker als bisher im Wege der Einschränkung von administrativen Wertungsentscheidungen zu beschleunigen versucht. Ausgehend von der neueren Erkenntnis, dass der massive Ausbau regenerativer Energien zunehmend mit den teils schon seit Jahrzehnten bestehenden Schutz- und Bewahrungsinteressen des Umweltschutzes kollidiert, stehen dabei solche Rechtsvorschriften im Zentrum der Betrachtung, mit denen für alle Rechtsbereiche verbindlich ein „überragendes bzw. überwiegendes öffentliches Interesse“ an den erneuerbaren Energien eingeführt und damit zugleich eine strikte Gewichtungsvorgabe für Schutzgüterabwägungen festgeschrieben wird.
Die Untersuchung arbeitet das Zusammenwirken jener gesetzlichen Aufwertungen einzelner Belange im Mehrebenensystem heraus und ordnet sie in die bisherige Abwägungsdogmatik ein. Darauf aufbauend diskutiert sie ihre planungspraktischen Auswirkungen und zeigt zugleich rechtlichen Optimierungsbedarf auf, mit denen sich die bestehenden bzw. zukünftig zu erwartenden Zielkonflikte zwischen Umwelt- und Klimaschutz besser lösen lassen.