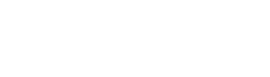Energie
Das Spannungsverhältnis zwischen Offshore-Windenergie und Meeresnaturschutz
Sebastian Löcker - Universität Bonn, Prof. W. Durner
Das Promotionsvorhaben thematisiert das Spannungsfeld zwischen den politischen Ausbauzielen der Offshore-Windenergie und dem Meeresnaturschutz.
Durch zahlreiche Gesetzesänderungen in den letzten Jahren verfolgt der deutsche Gesetzgeber das Ziel, den Ausbau der Offshore-Windenergie zu beschleunigen. Gemäß § 1 Abs. 3 WindSeeG 2023 (Windenergie-auf-See-Gesetz) soll die installierte Leistung von Offshore-Windenergieanlagen bis zum Jahr 2045 auf 70 Gigawatt gesteigert werden. Dies entspricht einer Leistung von circa 70 großen Kohlekraftwerken. Im Vergleich zum Ausbaustand im Jahr 2023 werden bis 2045 circa neunmal so viele Offshore-Windenergieparks in Betrieb sein wie heute.
Offshore-Windenergie hat das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu leisten. Neben der angestrebten Energiewende muss allerdings auch die Biodiversitätskrise beachtet werden. Die marine biologische Vielfalt und die Meeresökosysteme sind bereits jetzt in Nord- und Ostsee zu hohen Belastungen ausgesetzt. Der in Art. 1 Abs. 1 MSRL angestrebte „gute Zustand der Meeresumwelt“ ist in der deutschen Nord- und Ostsee noch nicht erreicht. In jeder Projektphase (Bau-, Betriebs- und Rückbauphase) greift der Offshore-Windenergie-Ausbau weiter in die Meeresumwelt ein. Der Ausbau der Offshore-Windenergie birgt das Risiko, den Verschlechterungsprozess in Nord- und Ostsee weiter voranzutreiben.
Der Gesetzgeber hat das Spannungsverhältnis zwischen Offshore-Windenergie und Meeresnaturschutz durch das sogenannte „Osterpaket 2022“ weiter verschärft. Klimaschutz und der anhaltende Ukraine-Krieg beschleunigen den Bedarf an Offshore-Windenergie in Deutschland. Der Umweltschutz, insbesondere der Schutz der Biodiversität, dürfen hierbei nicht vernachlässigt werden. Ein großes Problem beim Ausbau der Offshore-Windenergie liegt in den begrenzten Flächenkapazitäten in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Wo sollen Schutz- und Ausgleichsflächen herkommen, wenn die Offshore-Windenergie die begrenzten Flächen der deutschen AWZ bereits vollständig auslastet?
Ziel des Promotionsvorhabens ist es, den Zielkonflikt zwischen der Offshore-Windenergie und dem Meeresnaturschutz anhand des neuen nationalen, europäischen und völkerrechtlichen Rechtsrahmens zu beleuchten. Problemstellungen sollen aufgezeigt und Lösungsvorschläge sowie ein eventueller gesetzgeberischer Handlungsbedarf herausgearbeitet werden.
Veränderungen der Akteurslandschaft im europäischen Stromsektor: Der Prosumer im deutschen und polnischen Energierecht vor dem Hintergrund der unionsrechtlichen Vorgaben
Eva-Maria Thierjung - Universität Greifswald, Prof. S. Schlacke
Vor dem Hintergrund der sog. „green transition“ hat die Europäische Kommission im Jahr 2015 die Schaffung eines neuen Energiesystems angekündigt. Dieses soll sich auf erneuerbare Energien stützen und durch dezentrale Elemente auszeichnen; in seinem Mittelpunkt soll der Bürger stehen. Dies ist ein vollkommen neuer, revolutionärer Ansatz: Die traditionellen Versorgungsstrukturen sind auf das Agieren einiger weniger, zentral organisierter Akteure entlang linearer, vertikaler Strukturen ausgerichtet. Multiple (Rechts-)Beziehungen und hybride Handlungsformen waren bislang nicht vorgesehen.
Die Implementierung dieses neuen, europäischen Ansatzes im Stromsektor soll im Wesentlich durch Umsetzung der Regelungen betreffend vierer neuer Systembeteiligter - des aktiven Kunden, Bürgerenergiegemeinschaften, Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität und Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften – erfolgen. Nach Vorstellung des Richtliniengebers fungieren diese als Vehikel, um die bisher größtenteils passiven Endverbraucher in aktive Systemteilnehmer, dann häufig bezeichnet als Prosumer, zu wandeln.
Mit dem Forschungsvorhaben wird zunächst das unionsrechtliche Konzept, welches hinter diesen neuen Einzelregelungen steht, schärfer konturiert, um anschließend als Bewertungsmaßstab für die Beurteilung der Europarechtskonformität der mitgliedstaatlichen Umsetzungsrechtsakte zu dienen. Hierauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt die Implementierung der Vorgaben betreffend die vier neuen Akteure in das deutsche Recht analysiert. Dies erfolgt in einem rechtsvergleichenden Zugriff, wobei die polnische Rechtsordnung als Vergleichsrechtsordnung dient. Untersucht werden dabei nicht nur die einschlägigen Einzelregelungen, sondern auch ihr energierechtlicher und -politischer Gesamtkontext sowie ihre sozio-ökonomischen und geschichtlichen Hintergründe. Durch diese vergleichende Gegenüberstellung der Umsetzungslösungen zweier Staaten, deren Stromsektoren sich aufgrund einer Vielzahl an Gründen besonders stark voneinander unterscheiden, wird einerseits die tatsächliche Umsetzbarkeit der unionalen Prosumer-Idee als paneuropäisches Konzept geprüft. Andererseits und zuvörderst, dient dieser Ansatz jedoch dazu, neue, bisher unbekannte Umsetzungsmöglichkeiten auszumachen und auf diesem Weg einen Beitrag sowohl zur Europarechtskonformität des deutschen Rechts als auch zur Verwirklichung der Transformation im Stromsektor zu leisten.