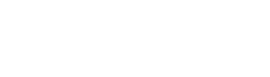Wasser
Rechtliche und tatsächliche Probleme der quantitativen Grundwasserbewirtschaftung - Eine rechtsvergleichende Untersuchung des kalifornischen Groundwater Bankings
Omid Bechmann - Universität Leipzig, Prof. K. Faßbender
Seit den Dürresommern 2018 und 2020 ist neben dem qualitativen auch das quantitative Grundwassermanagement verstärkt in den Fokus rechtswissenschaftlicher Diskussion geraten. So warfen die verursachten Pegelniedrigststände die Frage nach Steuerungs- und Durchsetzungskraft der Grundwasserschutz- und Zielvorschriften auf, deren Erreichung durch die Folgen des Klimawandels weiter erschwert wird. Nach einer eingehenden Realbereichsanalyse mit Blick auf die Herausforderungen gelingenden Grundwassermanagements unter Bedingungen des Klimawandels analysiert die Arbeit den wasserhaushaltsrechtlichen Ansatz des quantitativen Grundwasserschutzes, um dann den Blick zu weiten und gelingende Grundwasserbewirtschaftung als Querschnittsaufgabe zu begreifen. Hierfür werden ausgewählte Referenzgebiete wie das Bodenschutz- oder das Naturschutzrecht auf ihre unterstützenden Bewirtschaftungspotenziale hin untersucht. Dabei wird deutlich, dass sich Grundwasserschutz in Deutschland bislang vornehmlich auf Dargebotsmanagement kapriziert, während Dargebotsmehrung noch keine nennenswerte Rolle spielt. Konzepte wie das der Schwammstadt oder der Wasserspeicherung in der Fläche haben bislang keine nennenswerten Realeffekte hervorgebracht. In einem rechtsvergleichenden Schritt wird daher das kalifornische Bewirtschaftungsinstrument des Groundwater Bankings auf seine Umsetzbarkeit unter deutschem Recht hin untersucht: Hierbei werden Banken gebildet, die auf Anweisung ihrer Kunden Wasser in ausgewählten Grundwasserkörpern einleiten. Die Speicherung korrespondiert mit einem Entnahmerecht im Bedarfsfall; freilich gekoppelt an eine Gegenleistungspflicht. Die Vorteile dieses marktbasierten Instruments bestehen in seiner Aktivierung Privater hinsichtlich der Wasserspeicherung und der Möglichkeit der Stärkung des wasserrechtlichen Kompensationsprinzips. Die rechtliche Rezeption beider Aspekte weist vielversprechende Potenziale auf dem Weg zu einer nachhaltig gelingenden quantitativen Grundwasserbewirtschaftung auf.