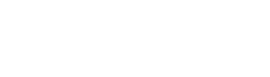Boden
Moorschutz im Umweltrecht
Thilo Tesing - Universität Bonn, Prof. W. Durner
Moore gelten als Mittel gegen den Biodiversitätsverlust und den Klimawandel und sind deshalb in den vergangenen Jahren vermehrt in den Fokus umweltpolitischer Strategien geraten. Aufgrund ganz besonderer und einzigartiger Eigenschaften sind Moore in naturnahem Zustand nicht nur Lebensstätte für verschiedene – z. T. bedrohte – Pflanzen- und Tierarten, sondern auch eine Senke für Kohlenstoff. Im entwässerten Zustand treten sie dagegen als Quelle von Treibhausgasemissionen auf. Derzeit befinden sich etwa 92 % der Moorböden in Deutschland in einem entwässerten Zustand. Um die Biodiversität in Deutschland zu erhalten und zu verbessern sowie den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, sollen intakte Moore in Zukunft konsequent(er) geschützt und entwässerte Moore möglichst renaturiert werden.
Während die Eigenschaften von Mooren in den Naturwissenschaften mittlerweile in zahlreichen Werken erforscht und dargestellt sind, haben sich die juristische Literatur und die Rechtsprechung bislang kaum mit der Rolle von Mooren in den verschiedenen Bereichen des Rechts beschäftigt. Das Forschungsvorhaben soll deshalb einen Beitrag zum Umgang mit Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Renaturierung von Mooren leisten. Ziel ist es, die Rolle von Mooren speziell im Umweltrecht darzustellen. Das Vorhaben soll beschreiben, wie das Recht derzeit versucht, Beeinträchtigungen von Mooren zu verhindern, und welche Vorschriften besonders zu beachten sind, wenn Maßnahmen zum Schutz oder zur Wiederherstellung von Mooren ergriffen werden. In diesem Zusammenhang soll die Arbeit auf bisher ungeklärte Rechtsfragen eingehen und so den Lesenden einen möglichst umfassenden Überblick über den Umgang mit Fragen des Moorschutzes und der Moorrenaturierung im Bereich des Umweltrechts verschaffen.