Biodiv-News
Gefahr für Streuobst durch Misteln
02.10.2025
Eine neue Pressemitteilung des Streuobstzentrums Hessen und des Deutschen Verbands für Landschaftspflege (DVL) warnt vor der wachsenden Gefahr durch Misteln in Streuobstwiesen. Die immergrünen Pflanzen entziehen ihren Wirtsbäumen Wasser und Nährstoffe, schwächen sie in heißen Sommern zusätzlich und können sogar zum Absterben führen. Besonders Apfelbäume sind betroffen, aber auch andere Laubbaumarten leiden zunehmend unter Mistelbefall.
Mit einer gemeinsamen Informationskampagne wollen DVL und das Streuobstzentrum Hessen aufklären, falsche Mythen, etwa den vermeintlichen Schutzstatus der Misteln, richtigstellen und zum aktiven Entfernen der Misteln aufrufen, um die wertvolle Kulturlandschaft der Streuobstwiesen zu erhalten.
Mehr Informationen: https://streuobstzentrum-hessen.de/2025/10/02/pressemitteilung-zur-gefahr-fuer-streuobst-durch-misteln/

Vielfältige Weiden – mehr Milch und weniger Methan?
01.10.2025
Ein Forschungsteam der Universität Göttingen hat in einer Meta-Analyse untersucht, ob artenreiche Weiden die Milchproduktion und Methanemissionen beeinflussen. Das Ergebnis: Mehr Pflanzenvielfalt auf der Weide steigert weder Milchleistung noch verringert sie Methanemissionen. Ein höherer Anteil an Leguminosen wie Klee kann jedoch die Milchproduktion fördern.
Dennoch lohnt sich Artenvielfalt im Weideland, betonen die Forschenden: „Betriebe sollten die Vorteile vielfältiger Grünlandflächen im Hinblick auf die Gesamtproduktivität und Ökosystemleistungen berücksichtigen, anstatt unmittelbare Verbesserungen bei der Milchproduktion oder Methan-Reduktion zu erwarten.“
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7927

Der Zustand der Umwelt in Europa bleibt besorgniserregend: Natur unter Druck und Klimawandel als größte Herausforderung
29.09.2025
Der aktuelle Bericht „State of Europe’s Environment 2025“ der Europäischen Umweltagentur (EEA) zeigt, dass sich der Zustand der Umwelt in Europa trotz einzelner Fortschritte insgesamt weiter verschlechtert. Insbesondere der Verlust an Biodiversität in terrestrischen, Süßwasser- und Meeresökosystemen bleibt ein zentrales Problem. Hauptursachen sind landwirtschaftliche Praktiken, Landnutzungsänderungen sowie Konsum- und Produktionsmuster.
Während in Bereichen wie Luftqualität, Treibhausgasemissionen, Kreislaufwirtschaft und erneuerbaren Energien Verbesserungen erzielt wurden, besteht die Gefahr, dass zahlreiche Umwelt- und Naturschutzziele bis 2030 nicht erreicht werden. Die EEA hebt die Bedeutung bestehender europäischer Politiken, insbesondere des Green Deal, hervor und empfiehlt eine konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ökosystemen und zum Schutz der biologischen Vielfalt.
Mehr Informationen: https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/state-of-europes-environment-2025

Forschungsteam fordert mehr Fokus auf genetische Vielfalt im Biodiversitätsschutz
26.09.2025
Die genetische Vielfalt – also die Unterschiede innerhalb einer Art – ist laut einem internationalen Forschungsteam eine zentrale, aber oft vernachlässigte Grundlage für den Biodiversitätsschutz. Sie ermöglicht Arten, sich an Krankheiten, Klimawandel und andere Umweltveränderungen anzupassen und trägt damit entscheidend zur Stabilität von Ökosystemen bei. Beispiele wie die Esche und Seegras zeigen, dass größere genetische Diversität die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Umweltstress deutlich erhöht. Trotz ihrer Bedeutung wird die genetische Vielfalt in Politik, Umweltberichten und Schutzstrategien bisher kaum berücksichtigt, obwohl moderne Analysemethoden ihre Erfassung zunehmend erleichtern. Die Forschenden fordern daher, genetische Diversität als gleichwertige Säule der Biodiversität in den „naturpositiven“ Ansatz des globalen Naturschutzes einzubinden, um langfristig eine Erholung der Natur zu erreichen.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news858776

Grünlandschmetterlinge – wichtige Indikatoren für den Zustand der Natur
23.09.2025
Ein Forschungsteam des UFZ und des Senckenberg SDEI hat für Deutschland erstmals den Index der Grünlandschmetterlinge berechnet – einen in der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur vorgeschlagenen Indikator für den Zustand der Biodiversität.
Die Auswertung von rund vier Millionen Beobachtungsdaten aus dem „Tagfalter-Monitoring Deutschland“ zeigt: Von 2006 bis 2023 haben vier Arten zugenommen, fünf sind rückläufig, bei sechs Arten ist der Trend unklar, und insgesamt tritt seit etwa 2016 ein deutlicher Rückgang auf.
Tagfalter gelten als besonders sensible Indikatoren, da sie stark auf Veränderungen in Landnutzung, Habitatqualität und Klimabedingungen reagieren.
Mehr Informationen: https://www.ufz.de/index.php?de=36336&webc_pm=34/2025

BUND erhebt weltweit erste Verfassungsklage auf bessere Naturschutz-Gesetzgebung
23.10.2024
Der Umweltverband BUND hat erstmals weltweit eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, um den Gesetzgeber zu verpflichten, ein umfassendes gesetzliches Konzept zum Schutz der biologischen Vielfalt zu schaffen. Ziel der Klage ist es, den fortschreitenden Verlust der Biodiversität zu stoppen und koordinierte Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur durchzusetzen. Der BUND betont, dass das Artensterben und die Zerstörung natürlicher Lebensräume gravierendere Folgen haben können als viele Klimaauswirkungen, da ohne stabile Ökosysteme grundlegende Lebensfunktionen wie Bestäubung, Wasserreinigung und Ernährungssicherheit gefährdet sind. Der Verband argumentiert, dass durch die Überschreitung planetarer Grenzen zentrale Menschenrechte – etwa auf Leben, Gesundheit und Nahrung – bedroht werden. Mit der Klage will der BUND ein juristisches Signal setzen und den Biodiversitätsschutz ähnlich wie den Klimaschutz als verfassungsrechtliche Verpflichtung verankern.
Mehr Informationen: https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/bund-erhebt-weltweit-erste-verfassungsklage-auf-bessere-naturschutz-gesetzgebung/

Neue Formel für die „Dienstleistungen“ der Natur
08.03.2024
Derzeit suchen Regierungen weltweit neue Ansätze, um den Nutzen und Wert von Ökosystemen angemessen zu bewerten. Dies soll helfen, die Konsequenzen von Naturzerstörung in politischen Entscheidungsprozessen sichtbarer zu machen. Ursprünglich im Auftrag der britischen Regierung hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Moritz Drupp von der Universität Hamburg nun einen neuen Berechnungsansatz vorgeschlagen. Dieser wird jetzt in der Zeitschrift „Science“ vorgestellt.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news829964

Gruppenjagd mit Ampel
08.03.2024
Der Gestreifte Marlin gehört zu den größten und schnellsten Raubfischen der Meere. Diese Art jagt in Gruppen kleine Fischschwärme, wobei ihr der lange, speerartige Maulfortsatz hilft. Eine Studie des Exzellenzclusters „Science of Intelligence (SCIoI)“ mit der Humboldt-Universität zu Berlin (HUB) und dem IGB haben eine mögliche Erklärung dafür, wie die Marline die rasante Abfolge ihrer Angriffe koordinieren, ohne sich dabei gegenseitig zu verletzen. Der Schlüssel dazu sind ihrer Erkenntnis nach schnelle Farbwechsel – wie bei einer Ampel. Helle Körperstreifen signalisieren: „Jetzt bin ich mit Jagen dran.“
Mehr Informationen:https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/gruppenjagd-mit-ampel

Elefanten, Giraffen & Co fördern vielfältige Ökosysteme
28.02.2024
Elefanten in Europa, Riesen-Wombats in Australien und Bodenfaultiere in Südamerika – solche großen Pflanzenfresser prägten viele Millionen Jahre lang die Ökosysteme an Land. Viele starben aus, als der Mensch sich global ausbreitete. Welche dramatischen Folgen das für die Ökosysteme hatte, ist nicht vollständig geklärt. Im Vergleich zu früher sind große Pflanzenfresser selten geworden. Heute sind die Arten mit weniger Individuen vertreten und viele sind vom Aussterben bedroht. Dabei beeinflussen wildlebende große Pflanzenfresser die Ökosysteme weiterhin in vielerlei Hinsicht von den Böden über die Pflanzen und kleineren Tiere bis zur strukturellen Vielfalt der Landschaft. Das zeigt ein internationales Team unter der Leitung von Forschenden der Universitäten Göttingen und Aarhus (Dänemark) mit einer Meta-Analyse über sechs Kontinente hinweg. Sie kommen zu dem Schluss, dass Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen große Pflanzenfresser einbeziehen sollten – auch, um Ökosysteme widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlicht.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7385

Fische könnten aussterben, wenn sie aufgrund steigender Temperaturen ihr Jagdverhalten ändern
27.02.2024
Wenn es wärmer wird, verändern Fische ihr Beutejagd-Verhalten. Modellrechnungen deuten darauf hin, dass diese Verhaltensänderung das Aussterben von Arten wahrscheinlicher macht, so eine neue Studie in der Fachzeitschrift Nature Climate Change. Die Forscherinnen und Forschern unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena fanden heraus, dass Fische in der Ostsee auf Temperaturerhöhungen reagieren, indem sie zunehmend die nächstbeste und einfach verfügbare Beute jagen. Das veränderte Jagdverhalten führte dazu, dass die Fische tendenziell kleinere und häufiger vorkommende Tiere fraßen, zum Beispiel kleine Krebstiere, Schlangensterne, Würmer und Weichtiere.
Mehr Informationen:https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5262.html

Artenschutzprüfung bei Windenergieausbau unterstützen
27.02.2024
Um einen beschleunigten Windenergieausbau mit den Biodiversitätszielen zu vereinbaren, müssen geeignete Flächen schnell ermittelt werden. Dazu hat das Fachgebiet Umweltprüfung und Umweltplanung der Technischen Universität (TU) Berlin mit Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) den neuen planerischen Ansatz der „Schwerpunkträume“ auf Tauglichkeit geprüft. Im Mittelpunkt stehen geschützte Arten wie etwa der Rotmilan.
Mehr Informationen: https://www.dbu.de/news/artenschutzpruefung-bei-windenergieausbau-unterstuetzen/

Rückgang von Insekten in naturnahen Wäldern
31.01.2024
Eine aktuelle Studie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) mit dem Titel „Long-term drought triggers severe declines in carabid beetles in a temperate forest.“ (Dürreperioden (oder: Trockenjahre) führen zum Rückgang von Insekten auch in naturnahen Wäldern) bestätigt den besorgniserregenden Rückgang von Insekten auch in naturnahen Ökosystemen. Seit 2015 ist die spezifische Biomasse um 89% zurückgegangen. Diese Abnahme korreliert mit den Dürreperioden im letzten Jahrzehnt.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news827890

Europas Wasserqualität: Besser, aber nicht gut genug
26.01.2024
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Senckenberg-Wissenschaftler Dr. James Sinclair und Prof. Dr. Peter Haase hat Fließgewässer 23 europäischer Länder untersucht. Anhand wirbelloser Tiere von 1.365 Standorten zeigen sie erstmals in ihrer heute im Fachjournal „Nature Ecology & Evolution“ erschienenen Studie die jährliche Veränderung der ökologischen Qualität der Flüsse seit den 1990er Jahren. Während diese insgesamt zugenommen hat, kam die positive Entwicklung um 2010 zum Erliegen. Die Forschenden warnen, dass der erforderliche „gute“ ökologische Zustand im Durchschnitt in den Fließgewässern nicht erreicht wurde.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/europas-gewaesserqualitaet-besser-aber-nicht-gut-genug/

Historische Parkanlagen leiden unter Klimastress – bundesweite Studie kommt zu alarmierenden Ergebnissen
26.01.2024
Forscher der TU Berlin haben erstmals von einem Großteil der historischen Parks und Gärten in Deutschland die Schäden an Gehölzen infolge des Klimawandels erfasst. Der Parkschadensbericht liefert eine Grundlage, um zielführend an einer Strategie zur Erhaltung dieses wichtigen Kulturgutes arbeiten zu können. Die Studie „Modellvorhaben Parkschadensbericht. Zustandserfassung der Schäden an Gehölzen in historischen Parks in Deutschland infolge des Klimawandels“ wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.
.png)
Auswirkungen extremer Trockenheit werden weltweit unterschätzt
09.01.2024
Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung einer Bayreuther Wissenschaftlerin und ihrer Arbeitsgruppe hat die Zusammenhänge zwischen extremer Trockenheit, Biodiversität und Produktionseinbußen auf globaler Ebene untersucht. Mithilfe eines weltweiten Experiments an 100 Standorten auf sechs Kontinenten haben sie erkannt: Artenvielfalt im Wirtschaftsgrünland ist ein wirksamer Schutz vor Ernteausfällen bei Dürren. Die Studie wurde nun in Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news826659

Konflikt auf Hochtouren: Waldfledermäuse meiden schnell drehende Windenergieanlagen weiträumig
04.01.2024
An Windenergieanlagen kommen nicht nur viele Fledermäuse zu Tode, die Anlagen verdrängen auch einige Arten weiträumig aus ihren Lebensräumen. Wenn die Turbinen bei relativ hohen Windgeschwindigkeiten in Betrieb sind, sinkt die Aktivität von Fledermausarten, die in strukturdichten Habitaten wie Wäldern jagen, im Umkreis von 80 bis 450 Meter um die Anlage um fast 80 Prozent. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung unter Leitung von Forschenden des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) und der Philipps-Universität Marburg, die in der Fachzeitschrift „Global Ecology and Conservation“ erschienen ist.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news826516

Fossile Vögel: Zum Zähne ausbeißen
04.01.2024
Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Gerald Mayr hat gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam ungewöhnliche Skelett-Strukturen verschiedener europäischer Vogel-Fossilien aus dem Eozän untersucht. Die Knochenoberflächen der etwa 40 bis 50 Millionen Jahre alten Halswirbel weisen auffällige knotenförmige Verdickungen auf, deren Ursprung bisher nicht geklärt werden konnte. In einer jetzt im wissenschaftlichen Fachjournal „Journal of Anatomy“ erschienenen Studie kommen die Wissenschaftler*innen auf Grundlage modernster Mikro-Computertomographie-Analysen zu dem Schluss, dass die Tuberkel als Teil eines inneren „Panzers“ zum Schutz vor tödlichen Raubtier-Nackenbissen gedient haben könnten.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/fossile-voegel-zum-zaehne-ausbeissen/
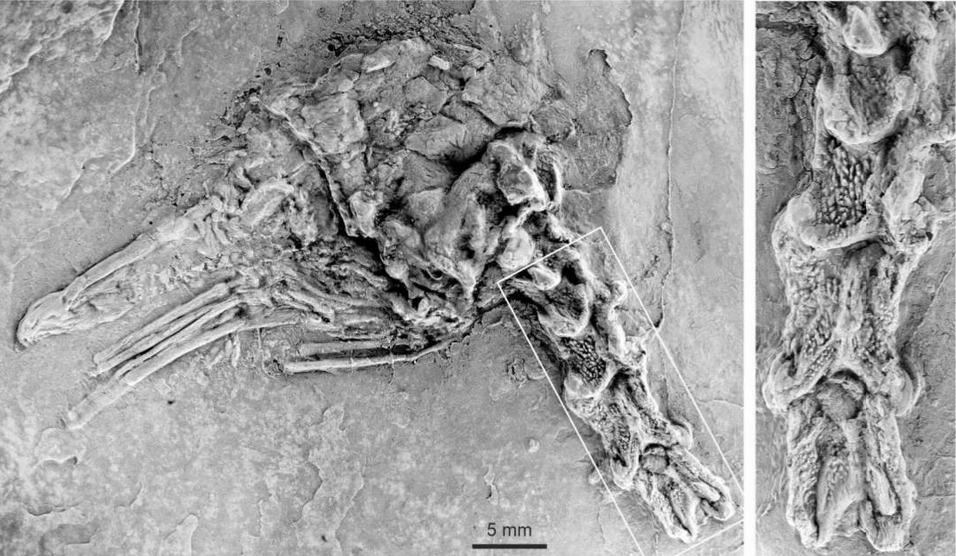
Jede zweite Art gefährdet oder ausgestorben
02.01.2024
Erstmals seit 2009 wurde die Rote Liste der gefährdeten Süßwasserfische und Neunaugen in Deutschland aktualisiert. Sie zeigt einen deutlich negativen Trend in den letzten 14 Jahren: 21 Arten wurden in der Gefährdungskategorie hochgestuft. Damit gelten nun mehr als die Hälfte der einheimischen Arten als gefährdet oder bereits ausgestorben. Eine negative Neubewertung erfuhr beispielsweise die Forelle (Salmo trutta), die von „nicht gefährdet“ auf „gefährdet“ hochgestuft wurde. Mit 10 Prozent ausgestorbenen Fischarten liegt Deutschland deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 2,5 Prozent. Zu den Ursachen gehören laut Fischexperten und Mitautor Dr. Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) der Verlust von Lebensräumen durch Gewässerverbauung und -verschmutzung sowie die Folgen des Klimawandels.
Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/jede-zweite-art-gefaehrdet-oder-ausgestorben

Wolf bald nur noch "geschützt", nicht "streng geschützt"?
21.12.2023
Die EU-Kommission will wegen der wachsenden Wolfspopulationen den internationalen Schutzstatus herabstufen lassen. Grundlage ist die Berner Konvention. Der Deutsche Tierschutzbund reagierte „zutiefst enttäuscht“. Der NABU kritisiert die Entscheidung als „Wahlkampfmanöver“. Der WWF veröffentlichte einen offenen Brief von rund 300 Nichtregierungsorganisationen, die die Orientierung an wissenschaftlichen Fakten fordern..
Mehr Informationen: https://www.dnr.de/aktuelles-termine/aktuelles/wolf-bald-nur-noch-geschuetzt-nicht-streng-geschuetzt

Paludikultur fördert Biodiversität, neue Lebenschancen für gefährdete Arten
19.12.2023
Bisher gibt es kaum Daten darüber, wie die Artenvielfalt auf Paludikultur reagiert. Eine neue Studie, die im Oktober 2023 vom Journal 'Scientific Reports' veröffentlicht wurde, wirft Licht auf diese Thematik. Die Multi-Taxon-Studie unter der Leitung von Wissenschaftler*innen der Botanik und Landschaftsökologie sowie der Zoologie der Universität Greifswald – Partner im Greifswald Moor Centrum – zeigt, dass Paludikultur den Erhalt der Artenvielfalt in wiedervernässten Niedermooren unterstützen kann.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news826179
Sensation im Eichenwald - Förster findet den nahezu ausgestorbenen Heldbock
14.12.2023
In einem Wald in Unterfranken wunderte sich Reiner Seufert, Mitglied der Vorstandschaft der Waldkörperschaft Gehaid über „Mordslöcher“ im Eichenholz. Bei der großen Dimension der Löcher stand ein Verdacht über den Verursacher schnell im Raum: Doch konnte eine solche Sensation wirklich stimmen? Der frühere Revierleiter der Bayerischen Forstverwaltung suchte weiter und fand im Holz eine frisch abgestorbene, verpuppte Larve. Eine DNA-Analyse, veranlasst durch die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) brachte nun Klarheit: Es handelt sich um den heimischen Heldbock (Cerambyx cerdo), den größten Käfer in unseren Wäldern. Der Fund gilt als absolute Besonderheit, da die Art vom Aussterben bedroht ist.
Mehr Informationen: https://www.lwf.bayern.de/service/presse/343237/index.php
Bedrohte Insektenvielfalt in Naturschutzgebieten – Empfehlungen aus dem Forschungsprojekt DINA
14.12.2023
Der Rückgang des Insektenaufkommens ist seit Jahrzehnten dokumentiert. Auch in deutschen Naturschutzgebieten geht die Zahl der Insekten insgesamt zurück, zudem ist die Artenvielfalt rückläufig. Das Forschungsteam im Projekt „DINA“ hat untersucht, woran das liegt und wie Lösungen zum Schutz der Insekten aussehen könnten. In einer aktuellen Publikation in der Zeitschrift „Environmental Sciences Europe“ stellt das Autorenteam, zu dem auch Wissenschaftler*innen des ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung gehören, Empfehlungen für einen wirksamen Insektenschutz vor. Entscheidend ist der lokale Dialog zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.
Mehr Informationen: https://www.isoe.de/news/bedrohte-insektenvielfalt-in-naturschutzgebieten-empfehlungen-aus-dem-forschungsprojekt-dina/
Artenreichtum unter der Erde
12.12.2023
Sie sind winzig klein, enorm vielfältig und im Erdboden weit verbreitet: wirbellose Bodenlebewesen wie Springschwänze, Hornmilben, Tausendfüßer oder Fadenwürmer. Im Ökosystem Boden übernehmen die oft nur unter dem Mikroskop sichtbaren Tiere wichtige Aufgaben. Daher rücken sie auch zunehmend in den Blickpunkt von behördlichen Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Boden. Doch durch welche Eigenschaften und Fähigkeiten genau zeichnen sich die einzelnen Arten aus, welche Informationen gibt ihr Erbgut preis und wie haben sie sich im Laufe der Evolution entwickelt? Mit dem Projekt „MetaInvert“ stellt ein internationales Team von Wissenschaftler*innen umfangreiche genomische Daten zu 232 Arten dieser bisher wenig erforschten Organismen bereit. Die Informationen tragen erheblich zur Identifizierung sowie zum Wissen über Zusammensetzung und Funktion von Gemeinschaften und die Entdeckung evolutionärer Anpassungen an Umweltbedingungen bei.
Bildgebung: Schonender Röntgenblick in winzige lebende Proben
08.12.2023
Ein neues System zur Röntgenbildgebung, das sich für lebende Proben, aber auch für empfindliche Materialien eignet, haben Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen mit Partnern in ganz Deutschland entwickelt. Mit ihm wird es möglich, Bilder mit mikrometergenauer Auflösung bei möglichst geringer Strahlendosis aufzunehmen. In einer Pilotstudie erprobten die Forschenden das Verfahren an lebenden parasitischen Wespen und konnten diese über 30 Minuten lang beobachten. Sie berichten in der Zeitschrift Optica.
Mehr Informationen: https://www.kit.edu/kit/pi_2023_105_bildgebung-schonender-rontgenblick-in-winzige-lebende-proben.php
Wie die Pflanzenwissenschaften unser Leben beeinflussen
07.12.2023
Das Kompetenzzentrum für Pflanzenwissenschaften der Universitäten Zürich und Basel und der ETH Zürich wird 25 Jahre alt. Zum Jubiläum präsentieren 12 Forschungsgruppen einige ihrer wichtigsten Entdeckungen in einer Online-Ausstellung. Wir zeigen anhand von fünf Beispielen, wie sich die Forschung an Pflanzen auf unser Leben auswirkt.
Text von Manuela Dahinden / Thomas Gull
Mehr Informationen: https://www.news.uzh.ch/de/articles/news/2023/plant-science-center.html
Kosten der Klimakrise: Rettungsschirm für bedrohte Nationen
30.11.2023
Die Folgen der Klimakrise treffen kleine Entwicklungsländer ganz besonders – nicht zuletzt auch finanziell. Eine Strategie, um sie vor den hohen Kosten klimabedingter Katastrophen zu schützen, haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der Risklayer GmbH – einer Ausgründung des KIT – und der University of Cambridge entwickelt: Demnach sollen öffentlich-private Partnerschaften eine zentrale Rolle bei der Unterstützung betroffener Länder einnehmen. Seine Ergebnisse hat das Team in einem Bericht veröffentlicht und stellt sie am Montag, 4. Dezember 2023 bei der UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) in Dubai vor.
Mehr Informationen: https://www.kit.edu/kit/pi_2023_100_kosten-der-klimakrise-rettungsschirm-fur-bedrohte-nationen.php
Eine Impfung gegen kranke Äcker
30.11.2023
Ackerböden beherbergen oft viele Krankheitserreger, die Pflanzen befallen und Erträge mindern. Ein Schweizer Forschungsteam hat nun gezeigt, dass eine Impfung des Bodens mit Mykorrhiza-Pilzen helfen kann, den Ertrag ohne zusätzliche Düngung und Pflanzenschutzmittel zu halten oder gar zu verbessern. In einem gross angelegten Freilandversuch konnte die Ernte um bis zu 40 Prozent gesteigert werden.
Mehr Informationen: https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2023/Aecker.html
Das „Wood Wide Web“ der Pilze sichern
23.11.2023
Trotz ihrer zentralen Rolle in vielen Ökosystemen wird die Bedeutung von Pilzen bei Renaturierungen und im Artenschutz bisher nur wenig betrachtet. Ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördertes Projekt der Universität Bayreuth will das ändern: Erstmals soll im Labor und in der Praxis erprobt werden, wie vom Aussterben bedrohte Pilzarten wieder angesiedelt werden können.
Mehr Informationen: https://www.dbu.de/news/das-wood-wide-web-der-pilze-sichern/
Mehr Biodiversität in Solarparks umsetzen
16.11.2023
Für die Solarenergie bestehen ambitionierte Ausbauziele. Bis zum Jahr 2040 sollen insgesamt 400 Gigawatt installiert sein, je zur Hälfte auf Dächern und Freiflächen. In der Photovoltaik-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums wird zudem eine Zukunftsvision entworfen, nach der im Jahr 2035 Biodiversitäts-Solarparks Standard sein sollen, die „neue Lebensräume für Tier- und Pflanzenwelt schaffen“. Wie lässt sich dieser Standard trotz Flächendruck und Nutzungskonkurrenzen erreichen? Welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es bereits, welche werden neu eingeführt?
Mehr Informationen: https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/mehr-biodiversitaet-in-solarparks-umsetzen-kne-startet-forschungs-und-entwicklungsvorhaben/
Eingeschleppte Arten spiegeln weltweite Biodiversität wider: Studie zeigt enormes Potenzial für Zunahme invasiver Arten
16.11.2023
Auf unseren globalisierten Handels- und Transportwegen verschleppen wir Menschen – ob absichtlich oder unabsichtlich – Pflanzen, Tiere, Bakterien oder Viren aus ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten in neue Lebensräume, wo sie zu großen Problemen führen können. Wie viele dieser gebietsfremden Arten es weltweit bereits gibt und welche Gruppen von Lebewesen besonders invasiv sind, hat eine Studie am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel untersucht, die jetzt in der Fachzeitschrift Global Ecology and Biogeography erschienen ist.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news824170
Vielfältige Wälder könnten riesige CO2-Speicher sein – aber nur, wenn die Emissionen sinken
13.11.2023
Laut einer neuen Studie könnte die Wiederherstellung natürlicher Wälder rund 226 Gigatonnen Kohlenstoff binden – allerdings nur dann, wenn die Menschheit auch ihre Treibhausgasemissionen stark reduziert. Zudem braucht es gemeinsame Anstrengungen zum Erhalt und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt.
Mehr Informationen: https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2023/11/vielfaeltige-waelder-koennten-riesige-co2-speicher-sein-aber-nur-wenn-die-emissionen-sinken.html
Natur wiederherstellen: Vorläufige Einigung steht
10.11.2023
Aufforsten, renaturieren, wiedervernässen: Donnerstagnacht haben Rat, Parlament und Kommission eine Einigung über die Naturwiederherstellungsverordnung (NRL) erzielt. Eine formale Bestätigung steht aber noch aus. Umweltverbände reagieren verhalten positiv, beklagen aber „Schlupflöcher“.
Mehr Informationen: https://www.dnr.de/aktuelles-termine/aktuelles/natur-wiederherstellen-vorlaeufige-einigung-steht
Rettung bedrohter Pflanzen | Neues Artenschutzprojekt auf der Pfaueninsel
09.11.2023
Mit einer gemeinsamen Aktion treten drei große Berliner Institutionen dem Artensterben entgegen: die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), der Botanische Garten Berlin (BO) und die Stiftung Naturschutz Berlin (SNB) haben sich zusammengetan, um auf der Pfaueninsel bedrohte Wildpflanzen vor dem völligen Verschwinden in Berlin zu retten.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news823718
Forschende mahnen, dass der Vorteilsausgleich für die biologische Vielfalt einen radikal neuen Ansatz erfordert
03.11.2023
Auf der COP-15-Tagung 2022 erzielten die Unterzeichnenden des Übereinkommens über die biologische Vielfalt ein neues Abkommen, das sogenannte Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, das Bestimmungen zur Einrichtung eines separaten, multilateralen Mechanismus für den Vorteilsausgleich für die Nutzung von "digitalen Sequenzinformationen" (DSI) enthält. DSI sind biologische Daten, die mit genetischen Ressourcen verbunden sind oder von diesen abgeleitet werden, wie Nukleotidsequenzen und epigenetische, Protein- und Metabolitdaten. In einer neuen Analyse des Policy Forum, die in der Zeitschrift Science (doi 10.1126/science.adj1331) veröffentlicht wurde, betonen die Forschenden, dass der internationalen Gemeinschaft nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung steht, um ein einfaches, harmonisiertes, effektives und transformatives Rahmenwerk für den Vorteilsausgleich bei DSI zu entwickeln. Die Autoren empfehlen, dass dieser neue Rahmen mit der bisherigen Art und Weise, wie Länder den Zugang und Vorteilsausgleich für biologisches und genetisches Material geregelt haben, brechen sollte.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news823321
Lehrbuchwissen auf den Kopf gestellt: 3-in-1 Mikroorganismus entdeckt
02.11.2023
Ein Team von Forschenden des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH und der Technischen Universität Braunschweig konnte jetzt in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und der University of Wisconsin, USA, zeigen, dass in der Natur eine unglaublich hohe Biodiversität umweltrelevanter Mikroorganismen vorherrscht. Eine Vielfalt, die das Bekannte mindestens um das 4,5-fache übersteigt. Die Forschenden veröffentlichten ihre Ergebnisse jüngst in den renommierten Fachzeitschriften Nature Communications und FEMS Microbiology Reviews.
Mehr Informationen: https://magazin.tu-braunschweig.de/pi-post/lehrbuchwissen-auf-den-kopf-gestellt-3-in-1-mikroorganismus-entdeckt/
Bereits wenig künstliches Licht gefährdet Ökosysteme
30.10.2023
Eine neue Sammlung von Studien über künstliches Licht bei Nacht zeigt, dass die Auswirkungen der Lichtverschmutzung weitreichender sind als gedacht. Selbst geringe Mengen künstlichen Lichts können Artengemeinschaften und ganze Ökosysteme stören. Die in der Fachzeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlichte Sonderausgabe mit 16 wissenschaftlichen Studien befasst sich mit den Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf komplexe Ökosysteme, darunter Boden-, Grasland- und Insektengemeinschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena betonen in der Sonderausgabe den Dominoeffekt, den Lichtverschmutzung auf Funktionen und Stabilität von Ökosystemen haben kann.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5202.html
Wie Soziale Medien zum Artenschutz beitragen können
27.10.2023
Fotos von Tier- und Pflanzenarten, die in den Sozialen Medien geteilt werden, können einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten – vor allem in tropischen Gebieten. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für Biodiversitätsforschung (iDiv), des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität von Queensland (UQ). In drei Studien, die in den Fachmagazinen BioScience, One Earth und Conservation Biology veröffentlicht wurden, zeigen sie am Beispiel Bangladeschs, dass Facebook-Daten einen wichtigen Beitrag zum Biodiversitätsmonitoring und zur Bewertung potenzieller Schutzgebiete leisten können.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5199.html
Innovative Technik beim Mähdreschen fördert die Artenvielfalt
26.10.2023
Klatschmohn, Kornblume und Feldrittersporn sind mittlerweile ein seltener Anblick. Durch den Einsatz von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bilden kulturbegleitende Ackerwildkräuter heute die am stärksten gefährdete Artengruppe in Mitteleuropa. Mit einem innovativen Verfahren beim Mähdreschen kann der Einsatz von Herbiziden verringert und die Artenvielfalt gefördert werden. Das Prinzip: Während der Getreideernte werden im Mähdrescher die Samen von Wildkräutern abgetrennt und aufgefangen. Diese gelangen somit nicht wieder auf den Acker, sondern können in Blühstreifen am Feldrand ausgesät werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) waren an der Erprobung dieses Verfahren bereits beteiligt und entwickeln es nun mit verschiedenen Partnern im Projekt „Entwicklung nachhaltiger Mähdruschtechnik für den Ökolandbau in Hessen“ (BioDruschTec) weiter. Das Land Hessen fördert das Projekt im Rahmen des Ökoaktionsplans Hessen von 2023 bis 2026 mit rund 655.000 Euro.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822970
Auf die Größe kommt es an: Natürliche Wiederbewaldung durch geflügelte Förster
24.10.2023
Unter der Leitung von Dr. Juan P. González-Varo von der Universität Cádiz in Spanien zeigt ein Team von 14 europäischen Forscher*innen, unter ihnen Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Jörg Albrecht, dass in weitgehend entwaldeten Gebieten fruchtfressende Vögel größer und mobiler sind als entsprechende Arten in Wäldern. Die Vögel in entwaldeten Gebieten verbreiten zudem bevorzugt die Samen von Pflanzen, die ihrerseits größer sind und größere Samen tragen als in Wäldern. In der im Fachjournal „PNAS“ veröffentlichten Studie geben die Forschenden auf Basis eines umfangreichen Datensatzes Empfehlungen für zukünftige Projekte zur Wiederbewaldung.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822747
Landwirtschaftliche Böden: Sorgsam mit der wertvollen Ressource umgehen
24.10.2023
In den letzten Jahrzehnten hat Deutschland kontinuierlich Landwirtschaftsfläche verloren, im Durchschnitt mehr als 50 Hektar pro Tag – oder 70 Fußballfelder. Im Gegenzug nahmen Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie Waldgebiete zu. Auch wenn dies die Nahrungsversorgung des Landes nicht akut gefährdet, so ist Landwirtschaftsfläche eine kostbare und schützenswerte Ressource. Gerade in Mitteleuropa sind die Flächen fruchtbarer und ertragreicher als in den meisten anderen Regionen der Welt. Daher trägt auch Deutschland eine globale Verantwortung für den Schutz fruchtbarer Ackerflächen zur Nahrungsproduktion und sollte eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Bodennutzung einnehmen. In einer jetzt erschienenen Studie hat das Thünen-Institut geschätzt, wie viel Landwirtschaftsfläche bis 2030 für andere Nutzungszwecke in Anspruch genommen wird, wenn die aktuellen Planungen und Strategien Realität werden. So werden bis 2030 mehr als 200.000 Hektar für Siedlung und Verkehr benötigt, wenn der im „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ formulierte Bedarf umgesetzt wird. Der geplante Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Freiflächen-Photovoltaik, wird bis 2030 mehr als 100.000 Hektar Freifläche beanspruchen. Gleichzeitig werden für Biodiversität und Klimaschutz immer größere Flächen für naturnahe Lebensräume und Kohlenstoffsenken gefordert. Diese Ansprüche erfordern Flächennutzungsänderungen wie Aufforstungen, Gehölzpflanzungen und die Wiedervernässung von Mooren, die sich auf mehr als 500.000 Hektar summieren. Insgesamt ist das mehr als die dreifache Fläche des Bundeslandes Saarland.
Mehr Informationen: https://www.thuenen.de/de/newsroom/detail/landwirtschaftliche-boeden-sorgsam-mit-der-wertvollen-ressource-umgehen
Warum so viele Vögel bunte Augen haben
23.10.2023
Die Farbenpracht vieler Vogelarten sorgt dafür, dass Menschen sie gerne beobachten. Doch es lohnt sich ein genauerer Blick: Nicht nur das Gefieder bringt leuchtend grüne, blaue, rote oder gelbe Töne hervor, sondern auch die Augen sind bei einigen Federtieren recht bunt. Um herauszufinden, welche Gründe es dafür gibt, hat eine Gruppe um Eamon Corbett von der Louisiana State University in Baton Rouge mehr als 250 Einzelstudien ausgewertet und in »Ibis« publiziert. Das Team kommt dabei zu einem recht eindeutigen Schluss.
Mehr Informationen: https://www.spektrum.de/news/ornithologie-warum-so-viele-voegel-bunte-augen-haben/2192397?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1698048048
Warum sich manche Würmer regenerieren, andere aber nicht
20.10.2023
Wieso können nur wenige Arten verletzte oder fehlende Körperteile regenerieren, obwohl dies für das Überleben Vorteile bietet? Forschende am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften haben jetzt mit Kolleg*innen eine mögliche Erklärung gefunden, warum manche Arten in der Evolution die Fähigkeit zur Regeneration entwickelt oder wieder verloren haben. Dazu untersuchten sie bei verschiedenen Plattwurmarten, inwieweit diese ihren Kopf nachwachsen lassen können. Wie sie herausfanden, unterscheiden sich die Arten stark in dieser Fähigkeit, und zwar auch abhängig davon, wie sich die Tiere fortpflanzen.
Mehr Informationen:https://www.mpinat.mpg.de/4538381/pr_2317
Mittels Käfer-Evolution die geologische Geschichte Indonesiens erklären
18.10.2023
Eine neue Studie zu Rüsselkäfern unter der Leitung der Biologen Harald Letsch von der Universität Wien und Alexander Riedel vom Staatlichen Naturkundemuseum in Karlsruhe bringt fachübergreifende neue Erkenntnisse. Anhand der Evolution der dortigen Rüsselkäfer lassen sich Rückschlüsse auf die geologische Entwicklung Indonesiens und des Westpazifiks ziehen. Die Autor*innen konnten so Karten zur Landentwicklung in Indonesien und dem Westpazifik skizzieren, die 40 Millionen Jahre in die Vergangenheit schauen und zeigten dabei etwa, dass die Papuanischen Halbinseln bereits früher als bisher gedacht aus dem Meer aufragten. Die Studie wurde aktuell im Fachmagazin Ecography publiziert.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822455
KI-Modelle identifizieren Biodiversität anhand von Tierstimmen im tropischen Regenwald
17.10.2023
Tierlaute zeigen sehr gut an, wie es um die Biodiversität auf tropischen Wiederbewaldungsflächen bestellt ist. Das hat ein Team um Professor Jörg Müller mit Tonaufnahmen und KI-Modellen nachgewiesen.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822315
Klein und oho: Mikroorganismen und ihre Bedeutung für unsere Gewässer
17.10.2023
Ohne Kleinstlebewesen geht in Ökosystemen nichts: Pilze verdauen Nahrung vor, Parasiten dämmen Blaualgen ein, Wasserflöhe halten aquatische Nahrungsnetze zusammen. Am IGB arbeiten zahlreiche Forschende zu unterschiedlichen Mikroorganismen und erkunden dabei ebenso die Ökologie dieser Lebewesen als auch die Frage, inwieweit sie durch den Klimawandel und andere menschengemachte Veränderungen gefährdet sind. Die Ergebnisse faszinieren, zeigen aber auch, wie bedroht das vielfältige Leben in unseren Gewässern ist - selbst die von Mikroben.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822379
Brasilianischer Regenwald 2050: Frösche oder Immobilien?
16.10.2023
Senckenberg-Forschende haben gemeinsam mit einem brasilianisch-deutschen Team die Auswirkungen des Klimawandels auf die taxonomische und funktionale Diversität von Amphibien in der „Mata Atlântica“ untersucht. Der Regenwald an der Ostküste Südamerikas zählt zu den am stärksten bedrohten tropischen Waldgebieten und beherbergt über 50 Prozent der in Brasilien vorkommenden Amphibienarten. Die Wissenschaftler*innen zeigen in ihrer heute im Fachjournal „Perspectives in Ecology and Conservation“ veröffentlichten Studie, dass selbst eine moderate Entwicklung des Klimawandels enorme Auswirkungen auf die zukünftige Amphibienvielfalt hat – zusätzlich geraten Frosch und Co. durch wirtschaftliche Interessen in Bedrängnis.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/brasilianischer-regenwald-2050-froesche-oder-immobilien/
Daunen in Gefahr?
11.10.2023
Vögel auf Inseln sind durch invasive Tierarten stark bedroht. Ein prominentes Beispiel ist der neuseeländische Kiwi, dessen Bestand durch Frettchen und weitere invasive Räuber stark zurückgegangen ist. Aber auch andere Vögel auf anderen Inseln sind betroffen, zum Beispiel in Island: Ein Team unter Leitung des Forschungszentrums Snæfellsnes der Universität von Island und des IGB hat mit Hilfe ungewöhnlicher Citizen-Science-Daten aus über 100 Jahren gezeigt, dass der Amerikanische Nerz die heimische Eiderente im Brokey-Archipel um ungefähr 60 Prozent dezimiert hat. Dabei sind Eiderenten – anders als der neuseeländische Kiwi – durchaus an räuberische Säugetiere gewöhnt. In einer anderen isländischen Insellandschaft, dem Purkey-Archipel, hatte etwa die Rückkehr des heimischen Polarfuchses keinen erkennbaren Einfluss auf die Eiderentenpopulation – vermutlich aufgrund der gemeinsamen evolutionären Geschichte, in der die Eiderenten geeignete Abwehrstrategien gegen den Fuchs entwickelt haben.
Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/daunen-in-gefahr
Landnutzung: Mehr Nahrung produzieren und gleichzeitig mehr Kohlenstoff speichern
10.10.2023
Die Nahrungsmittelproduktion verdoppeln, Wasser sparen und gleichzeitig die Kohlenstoffspeicherung erhöhen – das klingt paradox, wäre aber, zumindest nach dem biophysikalischen Potenzial der Erde, theoretisch möglich. Nötig wäre allerdings eine radikale räumliche Neuordnung in der Landnutzung. Das haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), einem An-Institut der Universität Heidelberg, herausgefunden. Ihre Ergebnisse haben sie in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.
Mehr Informationen: https://www.kit.edu/kit/pi_2023_080_landnutzung-mehr-nahrung-produzieren-und-gleichzeitig-mehr-kohlenstoff-speichern.php
Hohe Berge, hohe Vielfalt: Seit wann steuern die Anden die Biodiversität Südamerikas?
10.10.2023
Mithilfe stabiler Wasserstoffisotope in vulkanischem Glas hat ein internationales Forschungsteam, unter ihnen Senckenberg-Geowissenschaftler Prof. Dr. Andreas Mulch, die Hebungsgeschichte des Anden-Plateaus untersucht. In ihrer heute im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America“ (PNAS) veröffentlichten Studie zeigen sie, dass einzelne Abschnitte des heutigen Hotspots für Artenvielfalt erst vor 13 bis 9 Millionen Jahren auf ihre aktuelle Höhe anstiegen. Die Andenbildung gilt als maßgeblich für die Entwicklung der biologischen Vielfalt in Südamerika.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/hohe-berge-hohe-vielfalt-seit-wann-steuern-die-anden-die-biodiversitaet-suedamerikas/
Förderung neuer Forschung im Jena Experiment – Fokus auf Ökosystem-Stabilität
10.10.2023
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert eine Forschungsgruppe im Jena Experiment für weitere vier Jahre mit insgesamt etwa fünf Millionen Euro. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Führung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig und der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden insbesondere die stabilisierende Wirkung von Biodiversität gegen extreme Klimaereignisse wie Trockenheit, Hitze oder Frost untersuchen.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5191.html
Darwin oder Kimura – Natürliche Selektion oder alles Zufall?
09.10.2023
Manche Geheimnisse der Natur beschäftigen Wissenschaftler*innen schon seit Jahrzehnten – dazu gehören auch die Prozesse, die die Evolution vorantreiben. So spaltet die Frage, ob bestimmte Unterschiede zwischen und innerhalb von Arten durch natürliche Auslese oder durch zufällige Abläufe verursacht werden, die Evolutionsbiolog*innen bis heute. Ein internationales Forscherteam hat nun Licht in eine wissenschaftliche Auseinandersetzung um die Evolutionstheorien von Darwin und dem japanischen Genetiker Kimura gebracht. Ihr Fazit: Die Debatte ist durch das Nebeneinander verschiedener Interpretationen verworren.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/natuerliche_selektion_oder_alles_zufall/
Mischwälder sind produktiver, wenn sie strukturell komplex sind
09.10.2023
Baumartenreiche Wälder sind besonders produktiv aufgrund ihrer erhöhten oberirdischen Strukturkomplexität. Das zeigt eine gemeinsame Studie der TU Dresden, Leuphana Universität Lüneburg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universität Leipzig, Universität Montpellier und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv). Die Ergebnisse sind im Journal Science Advances erschienen.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5193.html
Trend zur Vergrößerung der Augenflecken bei Schmetterlingen
04.10.2023
Die Studie, die in der Fachzeitschrift Cladistics veröffentlicht wurde, dokumentiert die evolutionären Beziehungen einer Gruppe tropischer Schmetterlinge anhand von DNA-Sequenzen und morphologischen Merkmalen. Die Forschenden beobachteten eine Veränderung des Musters der Augenflecken und bestätigten einen Trends zu größeren und weniger Augenflecken. „Die Eunica-Schmetterlinge, eine Gruppe mit 40 Arten, sind einzigartig, da sie eine große Variation in der Anzahl und Größe der Augenflecken auf der Unterseite ihrer Flügel aufweisen“, sagt Ivonne Garzón, Forscherin an der UNAM-Universität in Mexiko City und Hauptautorin der Studie. Die Studie analysiert eine wesentlich größere Datenmenge einer repräsentativen Stichprobe von Eunica-Schmetterlingen als frühere Studien.
Mehr Informationen: https://leibniz-lib.de/augenflecken-bei-schmetterlingen/
Neue globale Gefährdungseinschätzung der Amphibien
04.10.2023
Ein großes internationales Forscherteam hat die Gefährdung von mehr als 8.000 Amphibienarten untersucht. Die Ergebnisse wurden heute in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Koautor und SNSB-Zoologe Frank Glaw hat bei der Bewertung der Amphibien Madagaskars mitgearbeitet, wo fast 5% der weltweiten Amphibienarten leben.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news821760
Faire und nachhaltige Zukunft nach dem Bergbau
02.10.2023
Der Bergbau bringt enorme soziale und ökologische Veränderungen in eine Gemeinde: Landschaften, Lebensgrundlagen und das soziale Gefüge entwickeln sich parallel zur Industrie. Doch was passiert, wenn die Minen geschlossen werden? Welche Probleme hat eine Gemeinde, die ihren Hauptarbeitgeber und den Kern ihrer Identität und sozialen Netze verliert? Eine Wissenschaftlerin der Universität Göttingen empfiehlt Regierungen in einem Kommentar, wie sie solche Gemeinden erfolgreich durch den Übergang zu einer Wirtschaft ohne Bergbau steuern können. Auf der Grundlage früherer Erfahrungen mit industriellen Übergängen schlägt sie als effektivsten Weg einen dreistufigen Ansatz vor, in dessen Mittelpunkt die Zusammenarbeit der Interessengruppen steht. Der Ansatz umfasst eine frühzeitige Planung, Lösungen auf lokaler Ebene und Investitionen zur Förderung des wirtschaftlichen und personellen Wandels. Der Kommentar ist in der Fachzeitschrift Nature Energy erschienen.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7221
Grünes Band - Ein Ort für Frieden, Freiheit und Demokratie
30.09.2023
Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit betont der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die herausragende Bedeutung des Grünen Bandes. Der einstige innerdeutsche Grenzstreifen ist heute der längste durchgängige Biotopverbund Deutschlands sowie ein lebendiges Monument und eine Erinnerungslandschaft der europäischen Geschichte. Der BUND ruft die Kulturministerkonferenz am 11. Oktober daher auf, das Grüne Band auf die deutsche Vorschlagsliste für UNESCO-Welterbestätten zu setzen. An diesem außergewöhnlichen Ort ist Zeitgeschichte für heutige und kommende Generationen unmittelbar erlebbar und Erinnerung möglich.
Wichtiger zusätzlicher Treiber des Insektensterbens identifiziert
28.09.2023
Treten ungünstige Witterungsbedingungen kombiniert und über Jahre auf, kann das Insektenbiomassen langfristig schrumpfen lassen. Das zeigt ein Team um Professor Jörg Müller im Journal „Nature“. Insekten reagieren empfindlich, wenn Temperatur und Niederschläge vom langjährigen Mittel abweichen. Bei einem ungewöhnlich trockenen und warmen Winter sind ihre Überlebenswahrscheinlichkeiten verringert, bei einem nasskalten Frühjahr ist der Schlupferfolg reduziert. Ein kühler, feuchter Sommer setzt Hummeln und andere Fluginsekten bei der Fortpflanzung und der Nahrungssuche unter Druck. Treten mehrere solcher Witterungs-Anomalien in Kombination und über mehrere Jahre auf, kann dies die Insektenbiomasse großräumig und langfristig reduzieren. Das zeigt ein neuer Report im Journal „Nature“.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news821192
Abnahme der Artenvielfalt kann Verbreitung von Viren begünstigen
26.09.2023
Wie hängen Umweltveränderungen, Artensterben und die Ausbreitung von Krankheitserregern zusammen? Die Antwort darauf gleicht einem Puzzle. Ein Puzzlestück haben Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) nun im Fachmagazin „eLife“ beschrieben: Sie zeigen, dass die Zerstörung tropischer Regenwälder die Vielfalt an Stechmückenarten vermindert. Gleichzeitig werden widerstandsfähige Stechmückenarten häufiger – und damit auch deren Viren. Gibt es von einer Stechmückenart viele Individuen, können sich deren Viren schnell verbreiten.
Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/abnahme-der-artenvielfalt-kann-verbreitung-von-viren-beguenstigen
Studie bestätigt: Keine Erholung der Biomasse von Insekten
25.09.2023
Fünf Jahre nach Veröffentlichung der bekannten Studie zum Rückgang der Insektenbiomasse in Naturschutzgebieten in Deutschland hat das Projekt DINA (Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen) in Zusammenarbeit mit dem Entomologischen Verein Krefeld (EVK) die Insektenbestände in 21 ausgewählten Naturschutzgebieten in den Jahren 2020 und 2021 untersucht. Thomas Hörren, Vorsitzender des Entomologischen Vereins Krefeld, bestätigt eine anhaltend negative Entwicklung: „Ausgehend von den 2017 veröffentlichten Insektenbiomassen ist derzeit keine Erholung für die Jahre 2020 und 2021 erkennbar. Dieser Abwärtstrend der Insektenbiomasse kann für 10 Bundesländer im Nord-Süd-Gradienten bestätigt werden.“
Mehr Informationen: https://www.nabu.de/modules/presseservice/index.php?popup=true&db=presseservice&show=38882
KI für die präzise Beobachtung von Pflanzen in der Natur
22.09.2023
In den Pflanzenwissenschaften hilft künstliche Intelligenz (KI), eine mit herkömmlichen Methoden unerreichbare Menge an Daten zu sammeln und zu analysieren. Forschende der Universität Zürich konnten mit Hilfe von Big Data, maschinellem Lernen und Feldbeobachtungen im experimentellen Garten der Universität Zürich zeigen, wie Pflanzen auf eine sich verändernde Umwelt reagieren.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news821150
Colossal Biosciences unterstützt BioRescue bei der Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns
19.09.2023
Vom nördlichen Breitmaulnashorn gibt es Weltweit nur noch zwei lebende Weibchen. Die Partnerschaft mit Colossal Biosciences könnte dazu beitragen, die genetische Vielfalt einer zukünftigen Population von nördlichen Breitmaulnashörnern mittels musealer Proben wiederherzustellen
Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/colossal-biosciences-unterstuetzt-biorescue-bei-der-rettung-des-noerdlichen-breitmaulnashorns
Qual der Wahl: In welche Naturschutzgebiete sollte zukünftig investiert werden?
18.09.2023
Die Einrichtung und Erhaltung von Schutzgebieten ist eine Schlüsselmaßnahme zur Erreichung der während der Weltnaturkonferenz im Dezember 2022 festgelegten Ziele. Doch solche geschützten Areale müssen oft vielfältige Ziele, wie Klimaschutz oder Schutz der Artenvielfalt, erfüllen – dies führt nicht selten zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessensgruppen. Senckenberg-Forschende plädieren in ihrer gerade im Fachjournal „One Earth“ erschienenen Studie für eine flexible und transparente Auswahl von Schutzgebieten für die Verteilung von knappen Naturschutzgeldern. Ein neu von ihnen entwickeltes Online-Instrument ermöglicht die Gewichtung verschiedener Erhaltungsziele sowie den Echtzeitvergleich der Ergebnisse auf globaler Ebene.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/qual-der-wahl-in-welche-naturschutzgebiete-sollte-zukuenftig-investiert-werden/
Wie hessische Forschende Giftschlangen auf den Zahn fühlen
15.09.2023
Nicht nur in den Tropen führen Schlangenbisse zu gefährlichen Vergiftungen – auch Bisse europäischer Giftschlangen können ernste körperliche Beschwerden hervorrufen. Doch ihr Gift enthält auch Wirkstoffe, die künftig gegen bakterielle Krankheitserreger eingesetzt werden könnten. Wissenschaftler*innen des Gießener Fraunhofer Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME und des hessischen LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik erforschen die Gifte europäischer Schlangen und haben kürzlich den Giftcocktail der in Griechenland heimischen Milosviper entschlüsselt. Ihre Publikation ist in der Fachzeitschrift „Frontiers in Molecular Biosciences“ erschienen.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/wie-hessische-forschende-giftschlangen-auf-den-zahn-fuehlen/
Das erstaunliche Reich der Flechten: Kolumbianisch-deutsches Forschungsteam entdeckt 28 neue Arten im Amazonasgebiet
13.09.2023
Kolumbien ist das Land mit der dritthöchsten Artenvielfalt auf unserem Planeten, wenn es um die Diversität von Pflanzen und Wirbeltieren geht. Nun hat ein Forschungsteam des Botanischen Gartens Berlin gemeinsam mit seinen kolumbianischen Partnern belegt, dass diese Lebensfülle auch für die Organismengruppe der Flechten gilt: Nicht weniger als 666 Arten fanden sie auf Expeditionen im kolumbianischen Amazonasgebiet, darunter sind 28 neu für die Wissenschaft
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news820556
Bestäubung: Nicht nur auf die Bienen schauen
12.09.2023
Forscherinnen der Technischen Universität München (TUM) haben herausgefunden, dass in der Frühsaison Insekten wie Wespen, Käfer und Fliegen eine entscheidende Rolle für die Bestäubung von Pflanzen in städtischen Umgebungen spielen. Für die so bedeutende Artenvielfalt ist zudem das Nahrungsangebot entscheidender als beispielsweise die Flächenversiegelung, so die Studienautorinnen. Gärtner:innen bekommen dadurch eine Schlüsselfunktion für die Biodiversität und Bestäubung im städtischen Raum.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news820510
Invasive Arten: Globale Bedrohung für Natur, Wirtschaft, Ernährungssicherheit und menschliche Gesundheit
05.09.2023
37.000 gebietsfremde Arten wurden bis jetzt weltweit durch menschliche Aktivitäten eingeführt – mehr als 3.500 davon gelten als so schädlich, dass sie eine ernsthafte Bedrohung für die Natur und unsere Lebensqualität darstellen. Solche invasiven Arten spielen bei etwa 60 Prozent des weltweiten Aussterbens von Tieren und Pflanzen eine Schlüsselrolle. Die nicht-heimische Fauna und Flora verursacht zudem jährliche Kosten von über 392 Milliarden Euro, die sich seit den 1970er-Jahren in jedem Jahrzehnt vervierfacht haben. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Team, unter ihnen Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Hanno Seebens, in einem neu veröffentlichten Bericht des Weltbiodiversitätsrats (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Die Forschenden plädieren für einen präventiven Umgang mit invasiven Arten und einen länder- und sektorübergreifenden Ansatz ihrer Kontrolle.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/invasive-arten-globale-bedrohung-fuer-natur-wirtschaft-ernaehrungssicherheit-und-menschliche-gesundheit/
Die meisten Arten sind selten. Aber nicht sehr selten
04.09.2023
Über 100 Jahre Naturbeobachtungen haben ein potenziell universelles Muster der Artenhäufigkeit enthüllt: Die meisten Arten sind selten, aber nicht sehr selten, und nur wenige Arten sind sehr häufig. Diese sogenannte „globale Artenhäufigkeitsverteilung“ ist für intensiv untersuchte Artengruppen wie die Vögel mittlerweile lückenlos erfasst. Für andere Artengruppen wie die Insekten ist das Muster noch unvollständig. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der University of Florida (UF). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht. Sie zeigt, wie wichtig das Monitoring der Biodiversität ist, um die globale Artenhäufigkeit zu bestimmen und ihren Wandel zu verstehen.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5171.html
Einrichtung des Global Biodiversity Observing System (GBiOS)
01.09.2023
Wissenschaftler fordern die Einrichtung des Global Biodiversity Observing System (GBiOS), um die weltweite Artenvielfalt zu überwachen. Sie argumentieren, dass die derzeitigen Methoden unzureichend sind, um den beispiellosen Verlust von Artenvielfalt durch Lebensraumverlust, Ausbeutung und den Klimawandel zu verfolgen. Ähnlich einem globalen Netzwerk von Wetterstationen würde das GBiOS Technologie, Daten und Wissen kombinieren, um die Zusammenarbeit und den Austausch von Daten zwischen Ländern zu erleichtern. Ziel ist es, die dringend benötigten Informationen zur Überwachung von Veränderungen der Artenvielfalt bereitzustellen und gezielte Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Das GBiOS würde auch das auf der COP-15-Konferenz vereinbarte Globale Biodiversitätsrahmenprogramm unterstützen, indem es zu einem umfassenden Verständnis von Veränderungen der Artenvielfalt beiträgt und eine effektive Umsetzung von Maßnahmen ermöglicht.
Mehr Informationen: https://www.owwz.de/einrichtung-des-global-biodiversity-observing-system-gbios/
Fossile Stacheln offenbaren Vergangenheit der Tiefsee
01.09.2023
Am Boden der Tiefsee entstanden vor langer Zeit wohl die ersten noch sehr einfachen Lebensformen der Erde. Heute ist die Tiefsee bekannt für ihre bizarre Tierwelt. Wie sich die Gesamtheit der Lebewesen in der Zwischenzeit veränderte, wird intensiv erforscht. Einige Theorien besagen, dass die Ökosysteme der Tiefsee nach mehrfachen Massenaussterben und ozeanischen Umbrüchen immer wieder neu entstanden sind. Das heutige Leben in der Tiefsee wäre somit erdgeschichtlich vergleichsweise jung. Doch es mehren sich die Hinweise darauf, dass Teile dieser Welt deutlich älter sind als bislang gedacht. Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen liefert nun den ersten fossilen Nachweis für eine beständige Besiedlung der Tiefsee durch höhere wirbellose Tiere. Fossile Stacheln von irregulären Seeigeln lassen auf ihr dauerhaftes Vorkommen seit der Kreidezeit und ihre Evolution unter dem Einfluss schwankender Umweltbedingungen schließen. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift PLOS ONE erschienen.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7180
Männliche Schopfmakaken reagieren häufiger auf die Hilferufe verwandter Jungtiere
29.08.2023
Männliche Schopfmakaken (Macaca nigra) reagieren häufiger auf die Hilferufe ihrer Kinder, wenn diese an Konflikten beteiligt sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die unter der Leitung der Verhaltensökologin Prof. Dr. Anja Widdig von der Universität Leipzig und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig im Rahmen des Macaca Nigra Projektes (MNP) kürzlich abgeschlossen wurde. Die Forschenden untersuchten dafür über 24 Monate (2008 bis 2010) im Tangkoko-Naturreservat auf Sulawesi (Indonesien) das Verhalten von Schopfmakaken. Das International Journal of Primatology hat gerade eine Sonderausgabe veröffentlicht, die ausschließlich diesen vom Aussterben bedrohten Tieren gewidmet ist. Anlass dafür ist das 17-jährige Bestehen des Macaca Nigra Projekts.
Mehr Informationen: https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/maennliche-schopfmakaken-reagieren-haeufiger-auf-die-hilferufe-verwandter-jungtiere-2023-08-29
Kurios und kryptisch: neue Wandelnde Blätter entdeckt
28.08.2023
Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Göttingen hat sieben neue Arten von Wandelnden Blättern beschrieben. Die Insekten gehören zu den Stab- und Gespenstschrecken, die für ihre außergewöhnliche Erscheinung bekannt sind: Sie sehen Pflanzenteilen wie Zweigen, Rinde oder – im Fall der Wandelnden Blätter – Laubblättern zum Verwechseln ähnlich und sind durch die raffinierte Tarnung hervorragend vor Fressfeinden geschützt. Mit genetischen Untersuchungen deckten die Forschenden auch sogenannte kryptische Arten auf, die nach ihrer äußeren Gestalt nicht unterscheidbar sind. Die Erkenntnisse haben nicht nur eine Bedeutung für die systematische Erforschung der Wandelnden Blätter, sondern auch für den Schutz ihrer Vielfalt. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift ZooKeys erschienen.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7175
Biodiversität schützt vor Invasionen durch gebietsfremde Baumarten
23.08.2023
Die erste globale Studie zeigt das Ausmass der Invasion gebietsfremder Bäume auf der ganzen Welt. Die Nähe zu menschlichen Aktivitäten ist ein entscheidender Faktor für das Auftreten von Invasionen. Einheimische Artenvielfalt kann das Ausmass der Invasion nicht einheimischer Baumarten begrenzen.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news819401
Insektizide beeinflussen Wasserinsekten auf unerwartete Weise
22.08.2023
Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) gehören weltweit zu den am häufigsten eingesetzten Chemikalien und beeinträchtigen Ökosysteme wie Flüsse äußerst negativ. Ungeklärt ist bislang, welche genetischen Effekte in Insektenlarven, die in Flüssen leben, durch Pestizidbelastung hervorgerufen werden. Die aktuell im Fachmagazin Environmental Pollution veröffentlichte Studie legt erste Ergebnisse für eine veränderte Genaktivität vor.
Mehr Informationen: https://leibniz-lib.de/insektizide-beeinflussen-wasserinsekten-auf-unerwartete-weise/
DNA-Abstrich von Blättern zeigt enorme Vielfalt der Regenwaldbewohner
22.08.2023
Die allseits bekannten Wattestäbchen, mit denen wir während der COVID-19-Pandemie so vertraut geworden sind, könnten auch ein wertvolles Werkzeug sein, um Biodiversität zu erfassen. Zu diesem Ergebnis kam ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald, einem Standort des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI). Die Gruppe fand heraus, dass sich unzählige Vögel und Säugetiere durch einfaches Abtupfen der von den Tieren auf Blättern hinterlassenen DNA nachweisen lassen. Wie effektiv dieser Ansatz ist, zeigten die Wissenschaftler:innen in einem Ökosystem, das eine Vielzahl von Wildtieren beherbergt und in dem die Erfassung von Tieren bislang äußerst schwierig war - dem tropischen Regenwald. Ihre Studie veröffentlichten die Forschenden nun im Fachjournal Current Biology.
Mehr Informationen: https://www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/news/news-detail/article/complete/dna-abstrich-von-blaettern-zeigt-enorme-vielfalt-der-regenwaldbewohner/
Auf die genetische Vielfalt kommt es an
22.08.2023
Durch mehr Nachkommen in Jahren mit niedrigem Schädlingsbefall bleiben natürliche Tabak-Mutanten mit Abwehrschwäche in der Pflanzenpopulation bestehen. Ein Team von Forschenden am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena zeigt in einer aktuellen Studie in der Zeitschrift PNAS, dass eine einzelne Mutation, die unmittelbare Auswirkungen auf die pflanzliche Fitness hat, in natürlichen Pflanzenpopulationen langfristig erhalten bleibt. Wenn weniger Fraßfeinde in der Nähe sind, wachsen Pflanzen mit dieser Mutation sogar schneller und erzeugen mehr Nachkommen.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news819372
Einige Pflanzen behalten ihre abgestorbenen Blätter im Herbst, aus guten Gründen
15.08.2023Der Verbleib von abgestorbener Biomasse an Gräsern und Kräutern in der gemäßigten Klimazone ist weitverbreitet und korreliert mit bestimmten Pflanzeneigenschaften, welches den potentiellen Einfluss dieses Phänomens auf Ökosystemfunktionen impliziert. Dies sind die Hauptaussagen einer experimentellen Studie von über 100 Pflanzenarten, die zusammen von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), Universität Leipzig, der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, und der Karls-Universität Prag durchgeführt wurde. Die Studie wurde kürzlich in der wissenschaftlichen Zeitschrift Journal of Ecology publiziert.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5174.html
Bär-Mensch-Koexistenz neu gedacht
14.08.2023Eine ETH-Forscherin erstellt das erste Modell, das die Koexistenz von Mensch und Bär in einer Nationalparkregion Italiens auf einer Landkarte abbildet. Als Werkzeug für die Praxis identifiziert das Modell Massnahmen und Gebiete, die vorrangig sind für die Förderung der Koexistenz von Mensch und Bär. Das Modell wird auf den Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise angewendet, kann aber auch für andere Regionen und Grossraubtiere genutzt werden.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news819104
Kaum noch Erholung: Artenvielfalt in europäischen Flüssen stagniert
09.08.2023Wie die umfangreiche Studie zeigt, hat sich die biologische Vielfalt in Flusssystemen in 22 europäischen Ländern über einen Zeitraum von 1968 bis 2010 aufgrund der verbesserten Wasserqualität zunächst erholt. Seit 2010 stagniert die Entwicklung jedoch; viele Flusssysteme konnten sich nicht vollständig regenerieren. Die Forschenden empfehlen daher dringend zusätzliche Maßnahmen, um die Erholung der biologischen Vielfalt in Binnengewässern zu fördern. Dies sei auch angesichts aktueller und zukünftig steigender Belastungen – wie Verschmutzung, Versiegelung, Dürre, Erwärmung und die Ausbreitung invasiver Arten – dringend nötig. Die Studie wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht.
Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/kaum-noch-erholung-artenvielfalt-in-europaeischen-fluessen-stagniert
Zukunftsfähige Unterstützung des Feldhamsters
02.08.2023Er zählt zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten Westeuropas: der Feldhamster (Cricetus cricetus), auch Europäischer Hamster genannt. Einst als massenhaft auftretender „Erntevernichter“ und „Plage“ sowie für seine mehrfarbigen Felle intensiv gejagt, wird seit den 1970er-Jahren ein deutlicher Rückgang seiner Bestände verzeichnet. Ohne weitere Forschung und Erhaltungsmaßnahmen könnte der Feldhamster laut Prognosen in den kommenden rund zwanzig Jahren vollständig aussterben. Dies in Hessen zu verhindern ist das Ziel des neuen Projekts „MetaHamster“, das vor allem genomische Daten in den Blick nimmt und an dem Wissenschaftler*innen und Naturschutzakteur*innen verschiedener Institutionen, darunter der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und des LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik (LOEWE-Zentrum TBG) in Frankfurt am Main, beteiligt sind. Das Projekt wird vom Land Hessen im Rahmen des Lore-Steubing-Instituts (LSI) für Naturschutz und Biodiversität des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) gefördert.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zukunftsfaehige-unterstuetzung-des-feldhamsters/
Raupe Nimmersatt: 60 Millionen Jahre alte Fraßspuren
01.08.2023Forschende des Hessischen Landesmuseums Darmstadt und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums Frankfurt haben entschlüsselt, welche Faktoren die enorme Vielfalt von pflanzenfressenden Insekten bestimmen. In ihrer heute im Fachjournal „PNAS“ erschienen Studie zeigen sie, dass sich die Diversität der herbivoren Insekten in den letzten 60 Millionen Jahren hauptsächlich durch die gemeinsame Nutzung von Nahrungspflanzen entwickelte. Hierfür analysierte das Forschungsteam die Fraßspuren von Gliedertieren an mehr als 45.000 fossilen Blättern.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/raupe-nimmersatt-60-millionen-jahre-alte-frassspuren/
Muster der Biodiversität entschlüsselt
24.07.2023Der Mensch ist eine große Bedrohung für die biologische Vielfalt. Um sie zu schützen, ist es wichtig, ihre Ursprünge zu verstehen. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Arten, die evolutionär einzigartig sind, das heißt wenige oder keine nah verwandten Arten haben, und nur in einem begrenzten Gebiet vorkommen, also endemisch sind. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen hat nun globale Muster der Verbreitung endemischer Samenpflanzen aufgedeckt und Umweltfaktoren ermittelt, die ihren Endemismus beeinflussten. Damit liefern die Forschenden wertvolle Erkenntnisse für den weltweiten Schutz von Biodiversität. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschienen.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7159
Klimakrise beschleunigt Artensterben – auch in den Anden
20.07.2023Die Erderwärmung verändert die Pflanzengemeinschaften der Berggipfel weltweit. In den südamerikanischen Anden, der längsten Gebirgskette der Erde, breiten sich Pflanzenarten in höher gelegenen Bergregionen aus, während immer mehr angestammte Gebirgspflanzen – auch von Arten aus Europa – zurückgedrängt werden. Zu diesem Befund kommt jetzt ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und BOKU Wien.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news818125
Neue Studie warnt: Menschengemachte Änderungen des Salzgehaltes gefährden Weltmeere und Biodiversität
17.07.2023In der hochgeachteten Fachzeitschrift »Global Change Biology« berichtet ein internationales Wissenschaftlerteam aus interdisziplinär Forschenden von renommierten Institutionen über die vor Kurzem publizierte Studie »Human-induced salinity changes impact marine organisms and ecosystems / Menschengemachte Salinitätsveränderungen beeinflussen marine Organismen und Ökosysteme«. Die neue Studie legt die kritische und doch wenig erforschte Rolle des Salzgehaltes im Wasser, der Salinität, in einem sich verändernden Ozean und entlang der Küsten offen. Damit bietet sie wertvolle Einblicke in die von menschlichen Eingriffen verursachten Bedrohungen durch Salinitätsveränderungen für marine sowie Küstenökosysteme und skizziert die Konsequenzen für die menschliche Gesundheit und Wirtschaft in den oft dicht besiedelten Regionen.
Mehr Informationen: https://www.ime.fraunhofer.de/de/presse/pressemitteilung-17-07-2023.html
Tiefseegraben: Müllhalde am Meeresgrund
13.07.2023Ein Team von Forscher*innen des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums Frankfurt, der Universität Basel und des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung, haben die aktuell umfangreichste Untersuchung von (Makro-)Plastikmüll in einer Tiefe von bis zu 9600 Metern vollendet. In ihrer im Fachjournal „Environmental Pollution“ erschienenen Studie analysierten die Forschenden die Anzahl, das Material und die Art der Plastikabfälle im pazifischen Kurilen-Kamtschatka-Tiefseegraben. Sie zeigen, dass die meisten Plastiküberreste aus dem regionalen Seeverkehr und der Fischerei stammen. Das Team warnt, dass Tiefseegräben zu „Müllhalden der Meere“ werden könnten.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/tiefseegraben-muellhalde-am-meeresgrund/
Internationale Forschende fordern: Beim Ozeanschutz auf Menschen in den Tropen hören
12.07.2023Um greifbare Lösungen für den Schutz der Ozeane zu finden, sollten wir den Menschen zuhören, die am meisten von den aktuellen Problemen der Ozeane betroffen sind: den Menschen in den Tropen. Das sagen 25 Autor:innen eines Kommentars, der in der Fachzeitschrift Ocean Sustainability veröffentlicht und vom Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) in Panama initiiert wurde. An der Publikation beteiligt war auch Estradivari, eine indonesische Meereswissenschaftlerin am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news817761
Verbesserungsfähig: Status Quo bei Schutzgebieten und Raubtieren
12.07.2023Deutschland hinkt bei der Ausweisung streng geschützter Schutzgebiete in der EU erheblich hinterher, zeigt eine Studie, die auch die Tagesschau aufgriff. Der Wissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments hat parallel ein Briefing zum Stand der Diskussion und dem Schutzstatus von Wolf, Bär und Co verfasst.
Mehr Informationen: https://www.dnr.de/aktuelles-termine/aktuelles/verbesserungsfaehig-status-quo-bei-schutzgebieten-und-raubtieren
Entlegene Pflanzenwelt
12.07.2023Ozeanische Inseln sind beliebte Modellsysteme in der Ökologie, Biogeografie und Evolutionsforschung. Viele bahnbrechende Erkenntnisse entstammen dem Studium von Arten auf Inseln und deren Wechselspiel mit ihrer belebten und unbelebten Umwelt – auch Darwins Evolutionstheorie. Nun hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen in einer großen Feldstudie die Pflanzenwelt der Kanarischen Insel Teneriffa untersucht. Die Ergebnisse sind anders als erwartet: Die Flora der Insel weist eine bemerkenswerte Vielfalt an funktionellen Merkmalen auf. Die Pflanzen weichen aber in funktioneller Hinsicht wenig von Pflanzen des Festlands ab. Doch anders als die Flora des Festlands wird die Flora Teneriffas von langsam wachsenden, verholzten Sträuchern mit einer konservativen Lebensstrategie dominiert. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Nature erschienen.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5165.html
Lokaler TV-Bericht auf Neukaledonien führt zur Entdeckung einer neuen Pflanzenart
04.07.2023Ein Team am Lehrstuhl für Pflanzensystematik der Universität Bayreuth hat vor kurzem eine neue Pflanzenart der Gattung Leichhardtia auf Neukaledonien nachgewiesen und in der Zeitschrift „Phytotaxa“ vorgestellt. Auslöser dieser Entdeckung war ein Fernsehbericht eines lokalen TV-Senders auf Neukaledonien über eine Forschungsreise zur schwer zugänglichen Insel Yandé nordwestlich der Hauptinsel Neukaledoniens.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news817258
Otter: Rückkehr der scheuen Jäger
29.06.2023Der Fischotter (Lutra lutra) war in Deutschland nahezu ausgerottet, breitet sich seit einigen Jahren aber wieder aus – und sorgt damit für Freude auf Seiten des Artenschutzes, aber auch für Konflikte mit der Fischereiwirtschaft. Das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur in Schleswig-Holstein (MEKUN) fördert am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) ein Kooperationsprojekt, um erstmals wissenschaftlich zu erarbeiten, wie groß das Konfliktpotential um den Fischotter tatsächlich ist. Das Projekt soll einen Beitrag zum ganzheitlichen Artenschutz leisten, der eine langfristige, friedliche Koexistenz zwischen Otter und Mensch in unserer Kulturlandschaft zum Ziel hat.
Mehr Informationen: https://www.tiho-hannover.de/universitaet/aktuelles-veroeffentlichungen/pressemitteilungen/detail/otter-rueckkehr-der-scheuen-jaeger
Wie Chemikalieneinsatz und der Verlust der Artenvielfalt zusammenhängen
29.06.2023Chemikalien in der Umwelt werden in der Wissenschaft nicht ausreichend als eine der Ursachen für den Schwund der Artenvielfalt in den Blick genommen. Dies zeigen 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungsnetzwerks RobustNature von Goethe-Universität und kooperierenden Instituten in einer Studie, die jetzt in der Zeitschrift „Nature Ecology and Evolution“ veröffentlicht worden ist. Die Forschenden sehen in einem interdisziplinären Ansatz eine neue Chance, den Verlust der Biodiversität besser zu verstehen, um effizienter Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Dazu untersuchen sie die Wechselwirkungen zwischen chemischer Belastung und Biodiversitätsverlust.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816917
Wie Korallenriffe den Klimawandel überstehen können
26.06.2023Einzelne Projekte der Tara-Pazifik-Expedition zur Erforschung der Korallenriffe veröffentlichen erste erstaunliche Ergebnisse – Der gesamte Datensatz wird öffentlich zur Verfügung gestellt – Biologe der Universität Konstanz ist Koordinator.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816661
Globale Analyse zu Bestäubern in Städten: Wildbienen und Schmetterlinge besonders gefährdet
22.06.2023Schmetterlinge leiden am meisten unter dem Wachstum von Städten. Schrumpfende Lebensräume und Nahrungsangebote lassen ihren Bestand zurückgehen. Gleiches gilt für viele Wildbienen, die im Frühjahr in Städten zu finden sind, wie ein Team der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften im Fachjournal "Ecology Letters" berichtet. Noch hat das keine Auswirkung auf die Bestäubung von Pflanzen, weil zum Beispiel Honigbienen die Effekte kompensieren können. Die Studie ist die erste umfassende Analyse zu dem Thema und beinhaltet Daten aus 133 Studien. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Naturschutzmaßnahmen in Städten.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816525
Mini-Schnecke im steinernen Sandwich
16.06.2023Forschende aus den USA und der Schweiz, unter ihnen Senckenbergerin und Erstautorin Dr. Adrienne Jochum, haben die ersten fossilen Carychium-Landschnecken aus Florida beschrieben. Die Gesteinsschicht mit den nur wenige Millimeter großen Schneckenfossilien wurde zufällig bei Bauarbeiten freigelegt und stammt aus der Zeit des Pleistozäns vor 2,58 Millionen bis 11.700 Jahren. In ihrer in der frei zugänglichen Zeitschrift „ZooKeys“ veröffentlichten Studie beschreiben die Wissenschaftler*innen zudem eine bislang noch unbekannte fossile Schneckenart.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/mini-schnecke-im-steinernen-sandwich/
Invasive Arten in Europa: Kostensteigerung um über 500 Prozent
15.06.2023Biologische Invasionen stellen eine große Bedrohung für die Ökosysteme, die biologische Vielfalt und das menschliche Wohlergehen dar und verursachen weltweit enorme wirtschaftliche Kosten. Eine neue Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Environmental Sciences Europe“, beleuchtet die wirtschaftlichen Auswirkungen, die durch biologische Invasionen in der Europäischen Union entstehen. Die Forschenden – unter ihnen Senckenberg- Wissenschaftler Dr. Phillip Haubrock – zeigen, dass aktuell nur für zwei Prozent der etablierten invasiven Arten Kosten ermittelt wurden und sich die Ausgaben in der Europäischen Union auf eine potenzielle Gesamtsumme von über 26,64 Milliarden Euro belaufen.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/invasive-arten-in-europa-kostensteigerung-um-ueber-500-prozent/
Klimawandel setzt Kohlenstoffvorräte in den Tiefen der Böden frei
14.06.2023Böden sind der größte Speicher für Kohlenstoff, aber auch eine der wichtigsten Quellen für CO2 in der Atmosphäre. Die Klimaerwärmung beschleunigt den Abbau des Humus. Dabei reduzieren sich auch die vermeintlich stabilen Wachs- und Holzstoffe, die den Pflanzen bei der Speicherung von Kohlenstoff in den Blättern und Wurzeln helfen. Dies zeigte eine Studie der Universität Zürich im Sierra Nevada National Forest in Kalifornien.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816030
Falter in Bedrängnis: Schmetterlinge reagieren auf Klimawandel
14.06.2023Ein Wissenschaftler-Team aus Österreich, Polen und Deutschland, unter ihnen Senckenberger Prof. Dr. Thomas Schmitt, hat die Auswirkungen des Klimawandels auf Tagfalter im österreichischen Bundesland Salzburg im Verlauf der letzten 70 Jahre untersucht. In ihrer nun im Fachjournal „Science of the Total Environment“ erschienenen Studie weisen die Forschenden nach, dass die Schmetterlinge empfindlich auf Klimaveränderungen und intensivierte Landwirtschaft reagieren.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/falter-in-bedraengnis-schmetterlinge-reagieren-auf-klimawandel/
Pflanzenökologische Studie in „Science“ zeigt dominierenden Einfluss des Klimas auf die Vegetation
12.06.2023Seit einigen Jahren wird in der ökologischen Forschung die These vertreten, das Klima habe oft keinen bestimmenden Einfluss auf die Verbreitung von Wäldern und Savannen in tropischen Regionen. Einem internationalen Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Steven Higgins an der Universität Bayreuth ist jetzt aber der Nachweis gelungen, dass es meistens von klimatischen Faktoren abhängt, ob Regionen in Afrika von Wald oder Savanne bedeckt sind. Die in „Science“ veröffentlichte Studie bekräftigt somit die dominante Rolle des Klimas für die Herausbildung globaler Vegetationsmuster.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news815844
Der Einfluss von Offshore-Windparks auf die Meeresumwelt geht weit über den eigenen Standort hinaus
06.06.2023Die Pfeiler von Offshore-Windrädern haben größere Auswirkungen auf die Meeresumwelt als bisher angenommen. Sie verändern die Durchmischung des Wassers und das weit über ihren eigenen Standort hinaus, wie Modellsimulationen von Forschenden des Helmholtz-Zentrums Hereon jetzt gezeigt haben. Ihre Ergebnisse veröffentlichte die Fachzeitschrift Frontiers.
Mehr Informationen: https://www.hereon.de/innovation_transfer/communication_media/news/111050/index.php.de
Neue Studie der Universität Bayreuth untersucht Möglichkeiten zur Ausweitung des Naturschutzes in der EU
05.06.2023Gefährdete und typische Lebensräume in Europa mit ihrer Artenvielfalt zu erhalten, ist das Ziel von Natura 2000, eines von der EU eingerichteten Netzwerks von Naturschutzgebieten. Bis 2030 wollen die EU-Mitgliedstaaten dieses Netzwerk erheblich erweitern. Eine neue, im „Journal for Nature Conservation“ erschienene biogeografische Studie der Universität Bayreuth zeigt: Natura 2000-Gebiete in finanzschwächeren EU-Mitgliedstaaten auf unmittelbar benachbarte Regionen auszuweiten, kann eine effektive Strategie zur Steigerung des Arten- und Landschaftsschutzes sein. Natürliche Lebensräume in diesen Regionen werden nur selten durch Siedlungen und wirtschaftliche Infrastrukturen geschmälert.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news815526
Wie Deutschlands Kommunen ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können
05.06.2023Unter dem Motto "Nachhaltigkeit aktiv gestalten – die Kommunen gehen voran“ haben die Bertelsmann Stiftung und die “Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global” mehr als 150 kommunale Expert:innen zu ihrem Kommunalkongress vom 05. bis 06. Juni 2023 nach Potsdam eingeladen. Aus diesem Anlass veröffentlicht die Bertelsmann Stiftung eine kommunale „Halbzeitbilanz“ zur Agenda 2030. Das Ergebnis: Die Kommunen in Deutschland machen beim Thema Nachhaltigkeit Fortschritte, sind aber noch nicht am Ziel. Deswegen zeigt die Studie 10 konkrete Maßnahmen, um die Nachhaltigkeitsziele in den Kommunen schneller zu erreichen.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news815480
Nutzungsaufgabe verändert die Natur
31.05.2023In den vergangenen 50 Jahren sind immer mehr Menschen vom Land in die Stadt gezogen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in oder nahe einer Stadt. Bis 2050 wird ein Anstieg auf etwa 70 Prozent erwartet. Zurück bleiben verlassene Felder, Weiden, Minen, Fabriken und ganze Dörfer. Seit den 1950er Jahren ist die Fläche der brachliegenden Landschaft weltweit auf ungefähr 400 Millionen Hektar angewachsen. Kriege und der Klimawandel treiben die Entwicklung zusätzlich voran. Wie sich die Veränderung auf die Natur auswirkt, ist noch wenig verstanden. Forschende der Universität Göttingen und des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Österreich zeigen nun, dass die Nutzungsaufgabe von Flächen sowohl eine Chance als auch eine Bedrohung für die Artenvielfalt sein kann. Sie machen klar, dass Brachflächen bei der Bewertung von globalen Wiederherstellungs- und Erhaltungszielen entscheidend sind. Die Ergebnisse sind in einem Beitrag in Science erschienen.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7110
Eine Alternative zu chemischen Pflanzenschutzmitteln
30.05.2023Besonders beim Gemüseanbau im Freiland werden häufig zur Bekämpfung von Unkräutern – sogenannten Beikräutern – Herbizide verwendet. Der übermäßige Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln kann allerdings negative Auswirkungen auf Mensch und Natur haben. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fordert daher, den Gebrauch zu reduzieren. Damit das gelingt, sind Alternativen gefragt: Ein Team aus Straubing in Bayern entwickelt mit DBU-Förderung ein umweltfreundliches, biobasiertes Mulchverfahren für den Gemüsebau.
Mehr Informationen: https://www.dbu.de/news/eine-alternative-zu-chemischen-pflanzenschutzmitteln/
Foto: © TFZ
Artenvielfalt zwischen Ölpalmen
25.05.2023Bauminseln in Ölpalmenplantagen können innerhalb von fünf Jahren die Artenvielfalt des landwirtschaftlichen Betriebs deutlich erhöhen, ohne die Produktivität zu verringern. Das hat ein Langzeitprojekt in Indonesien als Teil des Sonderforschungsbereichs „EFForTS“ an der Universität Göttingen gezeigt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler legten auf der Insel Sumatra experimentelle Bauminseln an, um der Artenverarmung durch den intensiven Anbau von Ölpalmen entgegenzuwirken. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Nature erschienen.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7101
Artenvielfalt fördern: Grünland bewahren
19.05.2023Der Biodiversitätsverlust auf der Welt ist verheerend. Pro Tag sterben Schätzungen zufolge 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Grund dafür ist etwa die Zerstörung natürlicher Lebensräume durch den Menschen. Aber auch die Klimakrise wirkt sich auf die Artenvielfalt aus. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) drängt anlässlich des Welttages der biologischen Vielfalt am 22. Mai auf verstärkten Schutz und eine schnelle Renaturierung von Lebensräumen. Passend dazu untersucht ein von der Stiftung gefördertes Projekt der Justus-Liebig-Universität Gießen Faktoren für eine erfolgreiche Aufwertung von landwirtschaftlich geprägtem Grünland durch Mahdgutübertragung.
Mehr Informationen: https://www.dbu.de/news/artenvielfalt-foerdern-gruenland-bewahren/
Biodiversitätsentdeckung: Unbekannte Arten (Dark Taxa) bestimmen die Vielfalt
18.05.202320 Insektenfamilien weltweit sind für 50 Prozent der Artenvielfalt der Fluginsekten verantwortlich – egal ob auf heimischen Wiesen oder in tropischen Wäldern. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommen Wissenschaftler:innen des Museums für Naturkunde Berlin, der Nationalen Universität Singapur, der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften und der Universität von Kalifornien (Riverside). Mit neuen Sequenzierungstechnologien werteten sie dafür Proben aus acht Ländern und zahlreichen Lebensräumen aus, die in allen fünf biogeografischen Regionen gesammelt worden waren.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news814543
Schmetterlinge auf Europas Wiesen und Weiden gehen weiter zurück. Eine neue EU-Verordnung soll diesen Trend stoppen.
16.05.2023Wiesen-Schmetterlinge werden in der Naturschutz-Gesetzgebung der EU künftig eine größere Rolle spielen. Denn anhand ihrer Vorkommen und Bestandsentwicklungen sollen die Mitgliedsstaaten dokumentieren, welche Fortschritte sie bei der Umsetzung der geplanten „Verordnung zur Wiederherstellung der Natur“ gemacht haben. Zum Einsatz kommen soll dabei der sogenannte Tagfalter-Grünland-Indikator. Diese Analyse, in die auch Daten und Expertise vieler Ehrenamtlicher unter Koordination von Fachleuten des UFZ eingeflossen sind, zeigt einen dringenden Handlungsbedarf. Denn seit den ersten Berechnungen im Jahr 1990 hat sich die Situation der Grünland-Falter in Europa deutlich verschlechtert.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news814399
Insekten & Co machen Wälder produktiver
9.5.23Wälder beherbergen 80 Prozent der weltweiten Pflanzen- und Tierartenvielfalt. Sie sind daher entscheidend für den Naturschutz. Doch die Artenvielfalt in Wäldern ist bedroht, vor allem durch Eingriffe des Menschen und den Klimawandel. Welche Bedeutung die Artenvielfalt für das Ökosystem hat, zeigt ein internationales Forschungsteam mit Forschenden der Universität Göttingen: Eine hohe Vielfalt an Baumarten wirkt sich positiv auf die Artenvielfalt und die Häufigkeit von Arthropoden wie Insekten, Spinnen und Tausendfüßern aus. Wie die Studie auch zeigt, tragen diese Arthropoden dazu bei, dass eine hohe Baumartenvielfalt die Produktivität im Wald fördert. In artenreichen Wäldern wird die Ausbreitung der pflanzenfressenden Arthropoden effektiver von jagenden und parasitären Arthropoden unterdrückt. Das begünstigt das Wachstum der Bäume.
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/891.html?id=7081
Gletscherschmelze bedroht Lebensräume von alpinen Fluss-Lebewesen
8.5.23Die Gletscherschmelze betrifft zahlreiche Lebewesen, die in von Gletscherwasser gespeisten Bächen heimisch sind. Mit zunehmendem Rückzug der Eismassen wärmen diese Gewässer auf und bedrohen so den Lebensraum ihrer Kaltwasser-Bewohner. Forschende der Eawag, des WSL und eines internationalen Teams haben nun eine Methode gefunden, zukünftige potenzielle Refugien für diese Kaltwasser-Lebewesen zu identifizieren. So wird es möglich, vorausschauend Regionen besser zu schützen, zu erhalten oder noch weiter auszubauen.
Mehr Informationen: https://www.eawag.ch/de/news-agenda/news-plattform/news/gletscherschmelze-bedroht-lebensraeume-von-alpinen-fluss-lebewesen/
Trotz Schutzverpflichtung: Europas letzte Urwälder verschwinden weiter
5.5.23Die letzten Urwälder sind in vielen Teilen der Welt, auch in Europa, bedroht. In den meisten Ländern Europas finden sich nur wenige Urwälder, die zudem in der Regel klein und isoliert sind. Ein internationales Forscher-Team warnt nun in einem Kommentar, der in Science veröffentlicht wurde, dass der Verlust der letzten Urwäldern Europas ungebremst voranschreitet, obwohl die EU Biodiversitätsstrategie 2020 ihren Schutz vorschreibt.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news813807
Nach der Umweltkatastrophe werden wieder Baltische Störe besetzt: IGB führt ehrgeiziges Wiederansiedlungsprogramm an der Oder fort
5.5.23Das IGB und das NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle führen gemeinsam mit dem Nationalpark Unteres Odertal und der Teichwirtschaft Blumberger Teiche einen Besatz mit Baltischen Stören in der Oder durch. Am 8. Mai 2023 werden rund 2.000 Jungtiere bei Stützkow in die Freiheit entlassen. Ursprünglich sollten die Tiere bereits im Herbst 2022 ausgewildert werden, doch das war aufgrund der menschengemachten Oder-Katastrophe nicht möglich. Nun starten die beteiligten Partner einen neuen Anlauf und setzen damit auch ein Zeichen für einen besseren Schutz unserer Flusslebensräume. Das Ziel des Programms ist es, eine sich selbst erhaltende Störpopulation im Fluss aufzubauen und so die imposanten Wanderfische vor dem Aussterben zu bewahren.
Mehr Informationen: https://www.igb-berlin.de/news/nach-der-umweltkatastrophe-werden-wieder-baltische-stoere-besetzt
Natur in der Stadt tickt anders: Eine Landkarte stadtökologischer Forschung gibt Überblick
04.05.23Wie überleben und entwickeln sich Tiere und Pflanzen in der Stadt? Die Stadtökologie ist ein schnell wachsendes Forschungsgebiet. Um Orientierung im Informationsdschungel zum Großstadtdschungel zu bieten, hat ein Team unter Leitung des IGB und der Freien Universität Berlin (FU Berlin) 62 Forschungshypothesen zur Stadtökologie in einer wissenschaftlichen Landkarte verortet. Darunter sind Annahmen wie die vom idealen Stadtbewohner, dem wagemutigen Städter, vom Leben auf Pump oder von der biologischen Monotonie der Städte. Wie belastbar die Hypothesen sind und auf welche Städte sie zutreffen, muss die Forschung noch zeigen. Die Übersicht bietet dafür eine wichtige Grundlage. Sie ist als offene Wikidata-Datei frei verfügbar.
Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/natur-in-der-stadt-tickt-anders
Fortschreitender Klimawandel: Wäldern des Mittelmeerraums droht Versteppung
02.05.23Mit dem Ziel, die Konsequenzen des menschengemachten Klimawandels für mediterrane Ökosysteme vorherzusagen, haben Geowissenschaftler der Universität Heidelberg natürliche Klima- und Vegetationsschwankungen der vergangenen 500.000 Jahre untersucht. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich diese Schwankungen auf die Wälder im Mittelmeerraum ausgewirkt haben. Dazu analysierten die Forscher um Dr. Andreas Koutsodendris fossile Pollen, die in einem Sedimentkern aus Griechenland erhalten geblieben sind. Ihre Untersuchungen deuten darauf hin, dass bei anhaltender Trockenheit – wie sie aktuelle Klimamodellierungen vorhersagen – in der nahen Zukunft mit einer Versteppung der Wälder im Mittelmeerraum zu rechnen ist.
Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news813539
Klima- und Biodiversitätskrise dürfen nicht isoliert betrachtet werden
21.04.2023Mehr Informationen: https://www.kit.edu/kit/pi_2023_klima-und-biodiversitaetskrise-duerfen-nicht-isoliert-betrachtet-werden.php
Große Tiere gehen es langsamer an um nicht zu überhitzen
19.04.2023Ob sich ein Tier nun fliegend, laufend oder schwimmen fortbewegt – das jeweils optimale Tempo ist immer davon abhängig, wie effektiv das Tier sich der überschüssigen Wärme entledigt, die von seinen Muskeln erzeugt wird. Das ist das Ergebnis einer Studie, die nun unter Leitung von Forschenden des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Fachmagazin PLOS Biology veröffentlicht wurde.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5136.html
Invasive Arten richten so viel Schaden an wie Naturkatastrophen
18.04.2023Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/invasive-arten-richten-so-viel-schaden-an-wie-naturkatastrophen/
Wie chemische Verschmutzung die Artenvielfalt bedroht
17.04.2023Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news812626
Fossile Käferart beschrieben, die erstaunliche Körpermerkmale aufweist
12.04.2023Die neue Art Midinudon juvenis ist nicht nur kleiner als heutige Kurzflügler (Staphylinidae), sondern verfügt auch über Merkmale, die normalerweise nur in ihren Larvenstadien zu beobachten waren. Doch wieso unterscheidet sich diese Art so stark von den heute lebenden Arten? Waren es Umwelteinflüsse, die ihre Entwicklung bis heute beeinflussten? In einer aktuellen STUDIE suchen Forschende um LIB-Käferexpertin Dagmara Żyła nach Antworten und beschreiben die neue Art aus dem kreidezeitlichen Bernstein.
Mehr Informationen: https://leibniz-lib.de/2023-04-12-kaeferart/
Gefährdete Ackerwildkräuter erhalten durch Finanzierung und Beratung
Forschungsteam der Universität Göttingen bestätigt Wirksamkeit von Förderprogrammen11.04.2023
Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7048
99 Riesenkrabbenspinnen-Arten
21.03.2023
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/99-riesenkrabbenspinnen-arten/
Weitverbreitete Arten auf dem Vormarsch
Arten mit größerem Verbreitungsgebiet profitieren von anthropogenen Veränderungen20.03.2023
Weitverbreitete Arten auf dem Vormarsch (idiv.de)
Internationales Projekt zum Erhalt der Biodiversität im Mittelmeerraum gestartet
20.03.2023Uni Kiel: Internationales Projekt zum Erhalt der Biodiversität im Mittelmeerraum gestartet (uni-kiel.de)
Bodenökosysteme weltweit leiden unter Kombination von natürlichen und menschgemachten Stressfaktoren
17.03.2023Mehr Informationen: Nature-Studie: Bodenökosysteme weltweit leiden unter Kombination von natürlichen und menschgemachten Stressfaktoren • Biologie • Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie (fu-berlin.de)
Bildquelle: Matthias Rillig
Größtes Genom eines Insekts entdeckt
16.03.2023Mehr Informationen: Größtes Genom eines Insekts entdeckt – LIB (leibniz-lib.de)
Zwerge und Riesen auf Inseln sterben besonders leicht aus
09.03.2023
Zwerge und Riesen auf Inseln sterben besonders leicht aus (idiv.de)
Ökologische Aufwertung von Gewässern nützt Fischen und Menschen
03.03.2023
Der Verlust der biologischen Vielfalt in Binnengewässern ist besorgniserregend. In groß angelegten Ganzseeexperimenten hat ein Forschungsteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) in Zusammenarbeit mit Angelvereinen 20 Seen ökologisch aufgewertet. Die Fische profitierten deutlich von den Verbesserungen der Lebensräume. Fischbesatz hingegen erzielte keine nachhaltig positiven Effekte. Die im Fachmagazin Science veröffentlichte Studie zeigt, wie wichtig es sowohl für den Artenschutz als auch für die fischereiliche Nutzung ist, Gewässer zu renaturieren und natürliche Prozesse zu fördern.
Mehr Informationen: Ökologische Aufwertung von Gewässern nützt Fischen und Menschen — Presseportal (hu-berlin.de)
Forschende des LIB entdeckten 172 neue Arten in 2022
03.03.2023
Mehr Informationen: Forschende des LIB entdeckten 172 neue Arten in 2022 – LIB (leibniz-lib.de)
Neues Projekt stärkt funktionelle Biodiversität im Obstbau. BMEL-Staatssekretärin übergibt Förderbescheide
02.03.2023
Mehr Informationen: JKI - Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen: Neues Projekt stärkt funktionelle Biodiversität im Obstbau. BMEL-Staatssekretärin übergibt Förderbescheide. (julius-kuehn.de)
Der Mulchzeitpunkt von Waldwiesen beeinflusst die Insektenvielfalt
01.03.2023
Mehr Informationen: Der Mulchzeitpunkt von Waldwiesen beeinflusst die Insektenvielfalt — Hochschul- und Wissenschaftskommunikation (uni-freiburg.de)
Invasive Pflanzenarten werden sich in Deutschland noch weiter ausbreiten
28.02.2023
Mehr informationen: Universität Leipzig: Invasive Pflanzenarten werden sich in Deutschland noch weiter ausbreiten (uni-leipzig.de)
Foto: Colourbox
Genomik für den Artenschutz
24.02.2023
Mehr Informationen:.Genomik für den Artenschutz | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Foto: Diego Delso, delso.photo
Faire Landnutzung: Wie lokale Interessengruppen bestmöglich von Landschaften profitieren
Studie zeigt Konfliktpotenzial aktuell diskutierter Landnutzungskonzepte und wie Kompromisse gelingen könnten
22.02.2023
Mehr Informationen: Faire Landnutzung: Wie lokale Interessengruppen bestmöglich von Landschaften profitieren | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Bucklige Verwandtschaft
Genomische Studie verdeutlicht die Vielfalt der weltweit verbreiteten Braunbären
21.02.2023
Mehr Informationen: Bucklige Verwandtschaft | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Foto: Gregoire DuboisQuelle: Pexels
Der Klimawandel gefährdet die Lebensräume von Meeresorganismen
15.02.2023
Sollte sich der Klimawandel im derzeitigen Tempo fortsetzen, bedroht dies die Lebensräume vieler Meeresorganismen. Darauf weisen die Ergebnisse einer Modellierungsstudie eines internationalen Forschungsteams hin. Demnach könnte rund die Hälfte der Meeresorganismen bis zum Ende dieses Jahrhunderts große Teile ihrer derzeitigen Verbreitungsgebiete verlieren.
Wie verändert sich die biologische Vielfalt weltweit? Genaue Trends zu erfassen ist derzeit kaum möglich
10.02.2023
Die verfügbaren Monitoringdaten sind wohl zu unpräzise, um verlässliche globale Durchschnittswerte aus den Trends der lokalen Artenvielfalt errechnen zu können. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Die Autorinnen und Autoren empfehlen, den Wandel der biologischen Vielfalt vorrangig auf lokaler und regionaler Ebene zu bewerten, statt diesen global darzustellen. Darüber hinaus raten sie zu standardisierten Monitoringprogrammen, ergänzt durch Modelle, die Messfehler und räumliche Ungenauigkeiten berücksichtigen.
Mehr Informationen: News single view (idiv.de)
Ökologie und Naturschutz im globalen Süden
10.02.2023
Die Tropen beherbergen den größten Teil der biologischen Vielfalt der Erde. Um dieses wertvolle Gut zu erhalten, müssen sich viele Menschen vor Ort engagieren und gut informiert sein. Die Tropenökologie und die Naturschutzwissenschaften sind jedoch noch häufig von kolonialistischen und diskriminierenden Praktiken geprägt, die den Erfolg des Naturschutzes beeinträchtigen können. Ein internationales Team führender Universitäten in der Tropenforschung hat nun vorgeschlagen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Globalen Südens, der häufig aus historisch durch den Kolonialismus geschädigten Nationen besteht, Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung besser fördern können.
Mehr Informationen: Presseinformationen - Georg-August-Universität Göttingen (uni-goettingen.de)
Foto: Projekt „Diversity Turn“
Wie sich nicht-einheimische Baumarten auf die biologische Vielfalt auswirken
26.01.2023
Nicht-einheimische Waldbaumarten können die heimische Artenvielfalt verringern, wenn sie in einheitlichen Beständen angepflanzt sind. Hingegen sind ihre Auswirkungen auf Bodeneigenschaften gering. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Übersichtsstudie mit Beteiligung der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.
Mehr Informationen: Wie sich nicht-einheimische Baumarten auf die biologische Vielfalt auswirken - WSL
Grasland-Ökosysteme werden mit zunehmendem Alter widerstandsfähiger
23.01.2023
Eine reduzierte Biodiversität beeinträchtigt die Stabilität des gesamten Ökosystems. Ein langfristig angelegter Versuch zeigt nun, dass Grasland-Pflanzengemeinschaften mit mehreren Arten etwa zehn Jahren brauchen, bis sie sich aufeinander eingestellt haben und wieder gleichmässig viel Biomasse produzieren können.
Mehr Informationen: UZH - News - Grasland-Oekosysteme
(Bild: Alexandra Weigelt)
Gebietsfremde Landschneckenarten nehmen exponentiell zu
19.01.2023
Invasive Landschneckenarten können heimische Arten verdrängen und der menschlichen Gesundheit schaden. Eine aktuelle Studie des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) schafft eine Übersicht über die exponentielle Zunahme und dynamische Ausbreitung von Landschneckenarten, die aus anderen Kontinenten nach Europa und in den Mittelmeerraum eingeschleppt wurden.
Mehr Informationen: Gebietsfremde Landschneckenarten nehmen exponentiell zu – LIB (leibniz-lib.de)
Bild: Reham F. Ali
Wie die Evolution arbeitet
05.01.2023
Welche genetischen Veränderungen sind für die Entwicklung phänotypischer Merkmale verantwortlich? Diese Frage ist nicht immer leicht zu beantworten. Eine neu entwickelte Methode macht die Suche jetzt deutlich einfacher.
Mehr Informationen: https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/single/news/wie-die-evolution-arbeitet/
Bild: Kenji Fukushima
Weniger Nachtfalter, mehr Fliegen
03.01.2023
Im hohen Norden des Planeten hinterlässt der Klimawandel besonders deutliche Spuren. Eine neue Studie in Finnland zeigt nun, dass es parallel dazu dramatische Veränderungen bei den bestäubenden Insekten gegeben hat. Forscherinnen haben festgestellt, dass sich das Netzwerk von Pflanzen und ihren Bestäubern dort seit dem Ende des 19. Jahrhunderts massiv verändert hat. Möglicherweise könne das dazu führen, dass Pflanzen künftig weniger effektiv bestäubt werden und sich dadurch schlechter vermehren, warnen die Wissenschaftlerinnen im Fachjournal Nature Ecology & Evolution.
Mehr Informationen: https://www.ufz.de/index.php?de=36336&webc_pm=01/2023
Foto: Wirestock_AdobeStock
Forschende weisen erstmals Auswirkungen des Klimawandels auf die Artenvielfalt von Trockenrasen nach
14.12.2022
Die Biodiversität von Trockenrasen ist innerhalb eines Vierteljahrhunderts deutlich zurückgegangen. Dazu sind Reste der Steppenvegetation aus der Eiszeit verschwunden. Trockenrasen sind besondere Habitate: Sie zeichnen sich durch einen großen Reichtum an seltenen und gefährdeten Pflanzenarten aus und bieten Insekten einen wichtigen Lebensraum. Es wachsen dort zahlreiche spezialisierte Gräser und Kräuter, aber auch seltene Orchideen. Viele Trockenrasenbestände liegen daher in Naturschutzgebieten. „Trockenrasen wachsen auf nährstoffarmen und trockenen Böden. Die Pflanzen sind gut daran angepasst, mit wenig Wasser auszukommen“, erklärt Dr. Thomas Becker. Umso überraschender waren für den Geobotaniker der Universität Trier die Ergebnisse einer Studie, die er gemeinsam mit Tim Meier, Isabell Hensen und Monika Partzsch von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg durchgeführt hat.
Mehr Informationen: Forschende weisen erstmals Auswirkungen des Klimawandels auf die Artenvielfalt von Trockenrasen nach - Universität Trier

Foto: Tim Meier/Universität Trier
DINA-Studie weist Verlust der Insektenvielfalt in Naturschutzgebieten durch umliegende Ackerflächen nach
08.12.2022
Das Insektensterben schreitet auch in deutschen Naturschutzgebieten voran. Ein Grund dafür ist die Intensivierung der Landwirtschaft. In einer Studie, die jetzt in der Zeitschrift „Biodiversity and Conservation“ erschienen ist, zeigt ein Autorenteam um die Biodiversitätsforscher Florian Dirk Schneider vom ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung und Sebastian Köthe vom NABU – Naturschutzbund Deutschland, dass auch außerhalb von Schutzgebieten gelegene Ackerflächen einen negativen Einfluss auf die Insektenvielfalt in den Schutzzonen haben können. Für einen wirksamen Insektenschutz empfehlen die Autor*innen den lokalen Dialog zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.
Mehr Informationen: DINA-Studie weist Verlust der Insektenvielfalt in Naturschutzgebieten durch umliegende Ackerflächen nach - ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung

Foto: NABU/Sebastian Hennigs
Biodiversität in Baumkronen: Es regnet Arten!
06.12.2022
Was lebt eigentlich in Baumkronen? Darüber weiß auch die Forschung nur wenig, denn der Lebensraum der Höhenbewohner ist nur schwer zugänglich. Biologen der Universität Duisburg-Essen (UDE) haben nun ein Verfahren getestet und in Environmental DNA veröffentlicht, mit dem Proben aus den Wipfeln vergleichsweise einfach zu nehmen sind. Das Wetter spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Mehr Informationen: Biodiversität in Baumkronen: Es regnet Arten! - Universität Duisburg-Essen

Wie Digitalisierung nachhaltige Landnutzung fördern kann
02.12.2022
Mittlerweile leben acht Milliarden Menschen auf der Welt. Ernährungssicherung wird zu einer der Herausforderungen unserer Zeit. Doch den Erhalt der Lebensgrundlagen gewährleisten am Ende nur gesunde Böden, mahnt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Blick auf den Weltbodentag am 5. Dezember. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Landwirtschaft. Die zwei DBU-geförderten Start-ups SmartCloudFarming, Berlin, und Phytoprove, Frankfurt, sowie ein mit Stiftungsmitteln unterstütztes Projekt des Laser Zentrums Hannover zeigen beispielhaft, wie es gelingen kann, das Land zu nutzen und dabei die Böden zu schonen.
Mehr Informationen: Wie Digitalisierung nachhaltige Landnutzung fördern kann - Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Falk Herrmann/piclease
Green Balance-Projekt gefördert - Universitätsklinikum Bonn erforscht städtische Grünflächen
29.11.2022
Bonn und Köln sind attraktive und beliebte Städte, die stetig wachsen. Mit der steigenden Einwohnerzahl und der Förderung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht auch immer mehr die Planung städtischer Grünflächen einher. Parks, Naherholungsgebiete, Wälder oder Wasserflächen sind beliebte Freizeitorte der Städterinnen und Städter. Doch was sind die Vor- und Nachteile, aber auch die Risiken dieser Grünflächen für die menschliche Gesundheit? „Insbesondere vektorübertragende Krankheiten, z.B. durch Zecken oder Stechmücken, aber auch allergische Beschwerden können durch die urbane Biodiversität an Bedeutung zunehmen. Diese Gesundheitsrisiken werden derzeit nicht systematisch erforscht und nur beiläufig in Grünflächenplanungen berücksichtigt“, so Prof. Nico Mutters, Direktor des IHPH am UKB.
Mehr Informationen: Universitätsklinikum Bonn erforscht städtische Grünflächen

Foto: Rolf Müller, Universitätsklinikum Bonn (UKB)
Offshore-Windparks verändern marine Ökosysteme
28.11.2022
Der Ausbau von Offshore-Windparks in der Nordsee geht voran. Doch die Konsequenzen für die marine Umwelt, in der sie errichtet werden, sind noch nicht vollständig erforscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Hereon haben zu den Auswirkungen von Windparks bereits in vergangenen Studien wertvolle Erkenntnisse geliefert. In ihrer neuesten Veröffentlichung zeigen sie nun, dass großangelegte Windparks die marine Primärproduktion sowie den Sauerstoffgehalt in und außerhalb der Windparkgebiete stark beeinflussen können.
Mehr Informationen: Offshore-Windparks verändern marine Ökosysteme (hereon.de)

Biodiversitätsverlust im Anthropozän: Senckenberg geht wegweisende Schritte für den Schutz von Natur und Mensch
28.11.2022
Im Zeitalter des Anthropozäns ist der Mensch eine gestaltende Kraft im Erdsystem geworden: Menschen verändern den Planeten Erde nicht nur für wenige Generationen, sondern für Tausende bis Millionen von Jahren. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat sich vollumfänglich für das strategische Erweiterungsvorhaben „Anthropocene Biodiversity Loss“ der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ausgesprochen. Der zuständige GWK-Ausschuss folgte am 20. September 2022 der im Juli vorausgegangenen Empfehlung des Wissenschaftsrats, die Senckenberg-Erweiterung in die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2024 aufzunehmen. Drei Schwerpunkte werden im Rahmen des Konzeptes dauerhaft etabliert: Collectomics, Biodiversity Genomics und die Solutions Labs. Ein achtes Senckenberg-Institut wird in Jena gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität etabliert.
Mehr Informationen: Biodiversitätsverlust im Anthropozän: Senckenberg geht wegweisende Schritte für den Schutz von Natur und Mensch
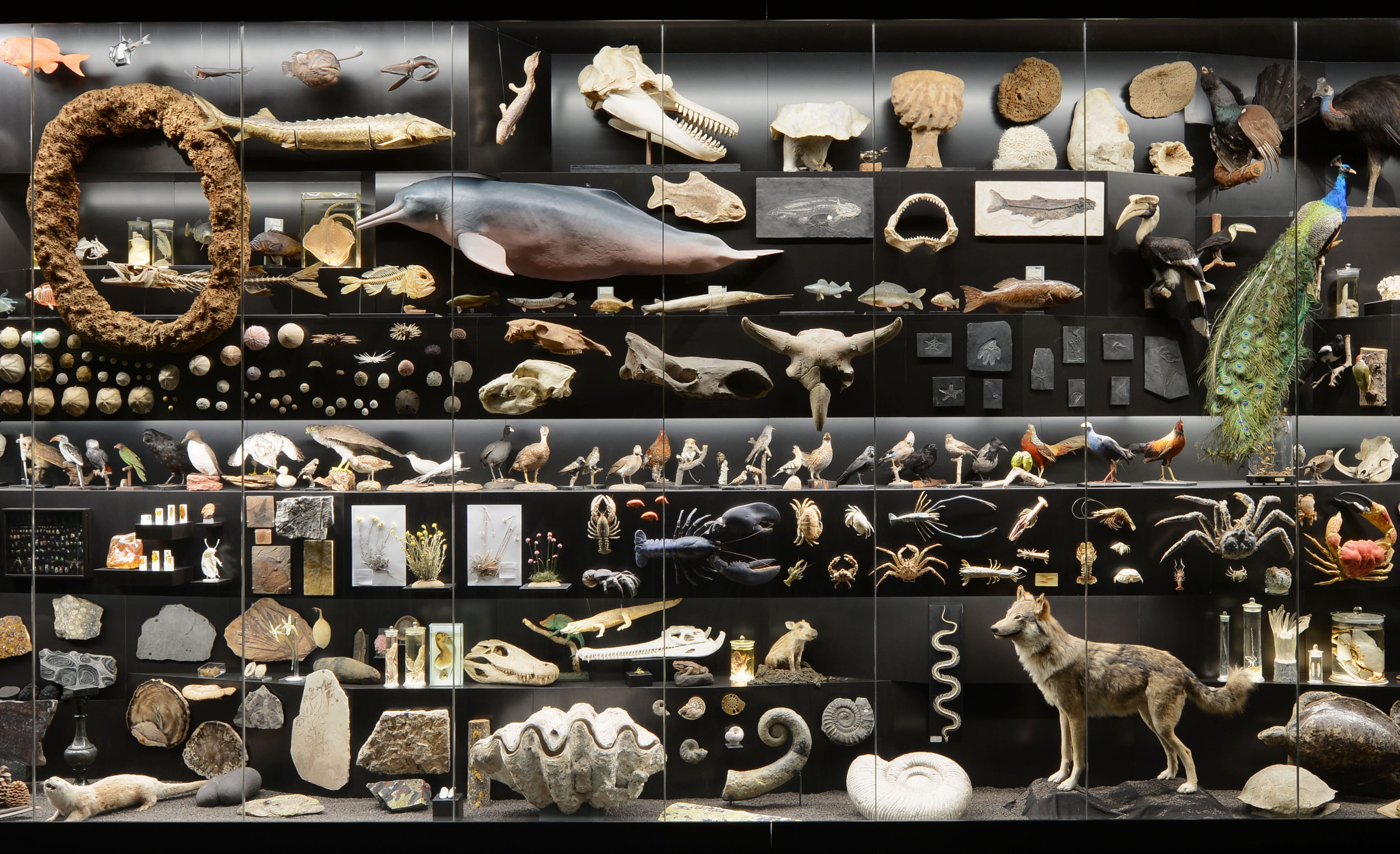
Vegetationsfreie Flächen fördern bodennistende Wildbienen
24.11.2022
Über die Nistansprüche bodennistender Wildbienen ist bisher relativ wenig bekannt, obwohl Nistplätze für die Förderung der meisten Wildbienenarten von zentraler Bedeutung sind. Von den knapp 600 Wildbienenarten in Deutschland nisten 75 Prozent im Boden, untersucht wurden bislang aber vor allem oberirdisch in Hohlräumen nistende Wildbienenarten. Ein Forschungsteam der Universität Göttingen hat nun mit einer Studie auf Kalkmagerrasen gezeigt, dass die kleinräumige Entfernung von Vegetation zu einer deutlichen Vermehrung von Bodennestern führte, vor allem bei angrenzendem, hohem Blütenreichtum.
Mehr Informationen: Presseinformationen - Georg-August-Universität Göttingen (uni-goettingen.de)

Foto: Hanna Gardein
Ja, es geht: Nahrungs- und Energieproduktion, Biodiversitäts- und Klimaschutz gemeinsam auf vorhandener Agrarfläche
24.11.2022
Kann zukünftige Nahrungsproduktion, nachhaltige Rohstoff- und Energieerzeugung, Biodiversitätsschutz und Wasserbewirtschaftung auf Deutschlands Agrarfläche in ausreichendem Maße gesichert werden? Ja, das geht, sagten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Strategischen Forum der DAFA vom 8.-9. November 2022. Der Vorstand der Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA) empfiehlt deshalb die Förderung des Ausbaus von Photovoltaik in Agrarlandschaften, Anpassung des genehmigungs- und förderrechtlichen Rahmens für Landnutzungsänderungen, Preise stärker mit gesellschaftlichen Erfordernissen in Einklang zu bringen und das gemeinsame Experimentieren von Wissenschaft und Praxis voranzutreiben.
Mehr Informationen: Nahrungs- und Energieproduktion, Biodiversitäts- und Klimaschutz gemeinsam auf vorhandener Agrarfläche - Deutsche Agrarforschungsallianz (DAFA)

Eine Weltkarte der Pflanzenvielfalt
15.11.2022
Warum gibt es an manchen Orten mehr Pflanzenarten als an anderen? Warum ist die Vielfalt in den Tropen am größten? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Artenvielfalt und Umweltbedingungen? Um diese Fragen zu beantworten, hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen die Verteilung von Pflanzenvielfalt auf der ganzen Welt rekonstruiert und hochauflösende Vorhersagen darüber gemacht, wie viele Pflanzenarten es wo gibt. Dies soll zum Schutz und Erhalt der Pflanzenvielfalt beitragen und Veränderungen im Hinblick auf die aktuelle Biodiversitäts- und Klimakrise bewerten. Die Forschungsergebnisse sind in der Fachzeitschrift New Phytologist erschienen.
Mehr Informationen: Eine Weltkarte der Pflanzenvielfalt - Georg-August-Universität Göttingen

Ökosystembasiertes Fischereimanagement rettet Fischbestände der Ostsee
14.10.2022
Das erste Ökosystemmodell, welches das gesamte Nahrungsnetz der westlichen Ostsee abdeckt, sagt voraus, wie Meereslebewesen der Region auf verschiedene Fischereiszenarien und zusätzliche vom Menschen verursachte Stressfaktoren reagieren würden. Die Modellsimulationen zeigen, dass ein ökosystembasiertes Fischereimanagement die Bestände kommerziell relevanter Fischarten und der gefährdeten Schweinswale wiederherstellen würde. Das Leben im Meer würde widerstandsfähiger, und es würden sich Optionen für eine zusätzliche Kohlenstoffspeicherung eröffnen, erklärt ein Team von Meereswissenschaftler:innen unter Leitung des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.
Mehr Informationen: Ökosystembasiertes Fischereimanagement rettet Fischbestände der Ostsee - GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
Erstmals Klassifizierung aller Lebensräume der Erde vorgelegt
12.10.2022
Von Wäldern über Steppen bis hin zu Mooren, Meeren und vielen mehr–die globale Vielfalt der Lebensräume ist überwältigend. Bis vor Kurzem gab es jedoch kein umfassendes, wissenschaftliches Klassifizierungssystem dieser Vielfalt. Ein internationales Forscher*innen-Team unter Beteiligung von Franz Essl vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien veröffentlicht nun in Nature erstmals eine Klassifizierung der Lebensräume der Erde. Die Wissenschafter*innen liefern damit eine wesentliche Grundlage für den dringend nötigen besseren Schutz von Lebensräumen.
Mehr Informationen: Erstmals Klassifizierung aller Lebensräume der Erde vorgelegt (univie.ac.at)
Bild: Franz Essl
Million Jahre alte DNA in Antarktis gefunden
05.10.2022
Mehr Informationen: https://www.uni-bonn.de/de/neues/215-2022
Foto: Sarah Kachovich
Schwerpunkt Artenvielfalt
04.10.2022
Mehr Informationen: https://www.ardalpha.de/wissen/natur/tiere/artenschutz/artenschutz-artenvielfalt-artensterben-schwerpunkt-100.html
Neue genetische Variation aus alten und exotischen Sorten für den umweltfreundlichen Weizenanbau
04.10.2022
Mehr Informationen: https://www.ipk-gatersleben.de/fileadmin/content-presse/Pressemitteilungen/2022_PM_10_Weizen_engl_final_KK.pdf
Deutschland steigert seine internationale Finanzierung
für biologische Vielfalt bis 2025 auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr
21.09.2022
Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern Abend in New York angekündigt, dass Deutschland ab 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro für den internationalen Biodiversitätsschutz bereitstellt. Das ist eine Verdopplung gegenüber den rund 750 Millionen Euro, die in den Jahren 2017-2021 im Durchschnitt investiert wurden. Die Mittel sind Teil der Erhöhung des Budgets für den internationalen Klimaschutz auf mindestens 6 Milliarden Euro pro Jahr bis spätestens 2025. Damit sendet die Bundesregierung ein wichtiges Signal zum Schutz von Wäldern und anderen gefährdeten Ökosystemen weltweit und für ein ambitioniertes Ergebnis der Weltnaturkonferenz im Dezember 2022 in Montreal.
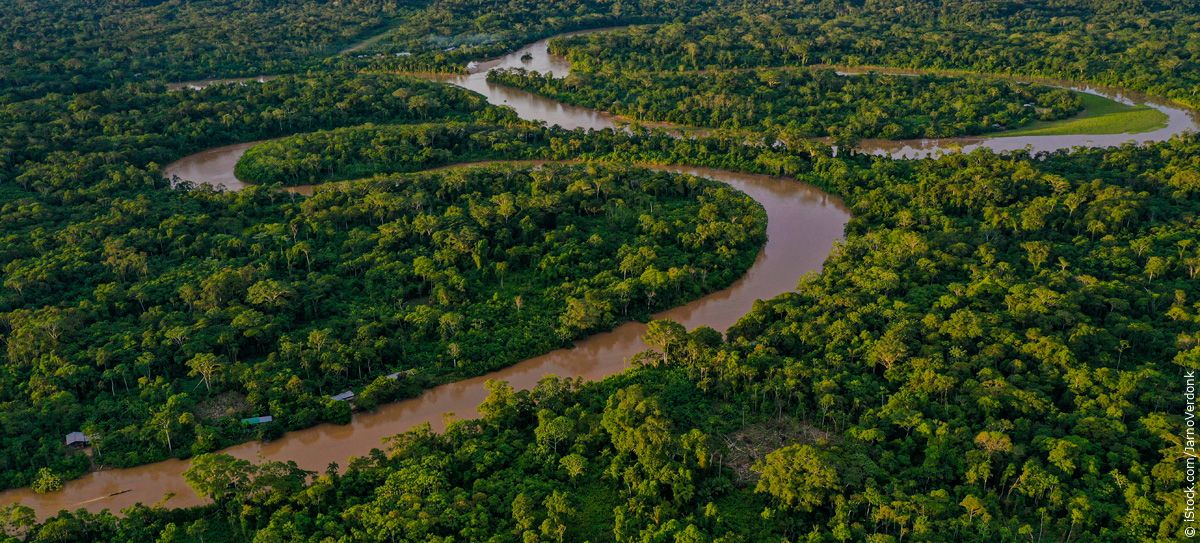
Lärm beeinflusst das Leben am Meeresboden
18.08.2022
Mehr Informationen: Presse Detailansicht - AWI
Bild: Sheng Wang
Zusammenhänge der biologischen Vielfalt in ganz Deutschland
besser verstehen
17.08.2022
Mehr Informationen: Zusammenhänge der biologischen Vielfalt in ganz Deutschland besser verstehen – LIB (leibniz-lib.de)
Nationalparke - Inseln in einer Wüste?
15.08.2022
Wie wirksam ist der Biodiversitätsschutz europäischer und afrikanischer Nationalparke? Dies scheint stark mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen zusammenzuhängen, in die sie eingebettet sind. Aber selbst unter den günstigsten Bedingungen können die Bedrohungen der biologischen Vielfalt in den Nationalparken nicht vollständig beseitigt werden, wenn sie nicht gleichzeitig auch außerhalb verbessert werden.
Mehr Informationen: Nationalparke - Inseln in einer Wüste? (idiv.de)
Bild: Hanspeter Mayr
Wie die Biodiversität in Weinbergen am besten gefördert wird
10.08.2022
Forschende der Universität Bern haben untersucht, wie sich eine biologische, biodynamische und konventionelle Bewirtschaftung in Weinbergen auf die Insektenfauna auswirkt. Sie konnten zeigen, dass biologische – und in einem geringeren Masse auch biodynamische – Bewirtschaftung bessere Lebensraumbedingungen für die Insekten bietet als konventionell bewirtschaftete Weinberge.
Mehr Informationen: Wie die Biodiversität in Weinbergen am besten gefördert wird (unibe.ch)
Bild: Pfammatter / Naturpark Pfyn-Finges
Mit der Natur rechnen heißt gesellschaftlich umdenken
09.08.2022
Unser wirtschaftlicher und sozialer Wohlstand hängt entscheidend von einer intakten, artenreichen Natur ab. Doch der wahre Wert unseres Naturvermögens und funktionierender Ökosysteme wird noch viel zu häufig unterschätzt - im Bewusstsein vieler Menschen ebenso wie in volkswirtschaftlichen Berechnungen und Unternehmensbilanzen. Aber es zeichnen sich Fortschritte ab. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und geplante Regulierungen auf internationaler Ebene bringen jetzt eine neue Dynamik in die ökologische Erweiterung staatlicher und privater Bilanzierungen. Vor diesem Hintergrund untersucht der Forschungsverbund „Wertschätzung von Biodiversität - Zur Modernisierung der Wirtschaftsberichterstattung in Deutschland“ (Bio-Mo-D), wie der Wert von Ökosystemleistungen und biologischer Vielfalt im Sinne einer ehrlichen Rechnung besser in nationale Berichte und Unternehmensbilanzen integriert werden kann. Nun erschien der Ergebnisbericht zum Stakeholder-Workshop am 7.7.2022 über die Chancen für eine Bilanzierung und Nutzung von Ökosystemleistungen in nationalen und unternehmerischen Entscheidungsprozessen.
Mehr Informationen: https://zenodo.org/record/6979392#.YxiyIXHP1D8
Globale Studie erforscht und gewichtet Ursachen für die
Vielfalt von Baumarten
09.08.2022
Die Anzahl der in den äquatornahen Regionen wachsenden Baumarten ist signifikant höher als in den weiter nördlichen und südlichen Regionen der Erde. Eine in „Nature Ecology and Evolution“ veröffentlichte internationale Studie untersucht die Ursachen hierfür mit einer zuvor nie erreichten Genauigkeit. Sie betont, dass die Vielfalt der Baumarten in den Tropen nicht allein von bioklimatischen Faktoren abhängt. Die Studie basiert auf einer Kooperation von 222 Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Mehr Informationen: https://www.uni-bayreuth.de/pressemitteilung/Artenvielfalt-Baeume
Mehr als eine Nummer: Die Vögel der Zukunft
03.08.2022
Senckenberg-Wissenschaftler*innen haben mit Kollegen der Technischen Universität München und der Universität Durham (UK) untersucht, wie sich die biologische Artengemeinschaften von Vögeln auf der ganzen Erde in Zukunft zusammensetzen könnten. Sie zeigen in ihrer Studie, dass sich die Vogelgemeinschaften – unter verschiedenen Klimawandel-Szenarien und der daraus resultierenden Verschiebung von Verbreitungsgebieten – bis 2080 weltweit über große Regionen stark verändern werden. Dies hat auch Auswirkungen auf Ökosystemleistungen, wie Samenausbreitung oder Bestäubung von Pflanzen.
Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/mehr-als-eine-nummer-die-voegel-der-zukunft/
(Foto: Stephen Willis)
Bestäubung durch Krebstiere
29.07.2022
Bis vor Kurzem bestand die Annahme, dass eine Bestäubung durch Tiere ausschließlich Pflanzen an Land vorbehalten ist. Ein internationales Forscherteam hat nun herausgefunden, dass kleine Meereskrustentiere die Vermehrung von Rotalgen fördern, indem sie das Sperma von den männlichen zu den weiblichen Organismen weitertragen. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass Meerestiere schon viel länger als Arten an Land eine Rolle bei der Befruchtung spielen.
Mehr Informationen: https://www.bio.mpg.de/de/artikel/pollination-by-crustaceans0/
(Foto: Wilfried Thomas)
LifeGate – Neue interaktive Karte zeigt die ganze Vielfalt
des Lebens
27.07.2022
Wissenschaftler aus Leipzig haben eine riesige, digitale Karte veröffentlicht, welche die ganze Vielfalt des Lebens in Tausenden Fotos zeigt. Das sogenannte LifeGate umfasst alle 2,6 Millionen bekannten Arten des Planeten und sortiert diese nach ihrer Verwandtschaft. Die interaktive Karte ist nun für jeden kostenlos nutzbar unter lifegate.idiv.de.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/3502.html
Bild: Martin Freiberg
Vielfalt auf dem Feld hält Unkräuter in Schach –
Wissenschaftlerinnen der Universität Rostock
untersuchen Unkraut in Mecklenburg-Vorpommern
22.07.2022
Wissenschaftler*innen untersuchten welchen Einfluss eine größere Vielfalt von Kulturpflanzen im ökologischen Anbau auf die Unkräuter hat. Die Studie zeigt, dass in artenreichen Ackervegetationen keine einzelnen Problemarten in großen Mengen auftreten, sondern bei vielen Arten kleine Mengen unterschiedlicher Unkrautarten vorkommen. Dazu gehören Unkrautarten, die jeder kennt: Klatschmohn, Kornblume, Kamillen, Knötericharten, Spörgel oder auch Hirtentäschelkraut.
Die artenreiche Ackervegetation hat durchaus Vorteile, denn Ackerunkräuter dienen als Nahrungsquelle und Habitat für Nützlinge.
Mehr Informationen: https://www.uni-rostock.de/universitaet/kommunikation-und-aktuelles/medieninformationen/detailansicht/n/vielfalt-auf-dem-feld-haelt-unkraeuter-in-schach-wissenschaftlerinnen-der-universitaet-rostock-untersuchen-unkraut-in-mecklenburg-vorpommern/
Foto: Bärbel Gerowitt/Universität Rostock
Mehr Arten als bisher angenommen könnten vom Aussterben
bedroht sein
18.07.2022
Im Mittel 30 Prozent aller Arten weltweit sind in den letzten 500 Jahren vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben. Dies ergaben Schätzungen von 3.331 Expertinnen und Experten, die sich mit der biologischen Vielfalt in 187 Ländern beschäftigen. Diese große und diverse Expertengruppe wurde im Rahmen einer Umfrage gebeten, Einschätzungen zum Wandel der von ihnen beforschten Arten zu geben. Die Ergebnisse sollen Wissenslücken bestehender wissenschaftlicher Bewertungen der globalen Biodiversität verringern und so die Wissensbasis für politische Entscheidungen verbessern.
Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/3482.html

Endstation Tiefsee: Mikroplastik belastet Meeresgrund noch stärker als angenommen
12.07.2022
Forschende haben die Mikroplastik-Verschmutzung des westpazifischen Kurilen-Kamtschatka-Grabens untersucht. Dabei fanden sie in jeder einzelnen von insgesamt 13 Sedimentproben aus bis zu 9450 Metern Tiefe zwischen 215 und 1596 Kleinstpartikel pro Kilogramm – mehr als zuvor nachgewiesen. Ihre erschienene Studie zeigt: Die Tiefsee ist der „Mülleimer der Meere“ – und bei der Ablagerung überraschend dynamisch. Die hohe Biodiversität am tiefsten Meeresgrund ist durch die Verschmutzung mit Mikroplastik stark gefährdet.
Foto: AWI
Wertschätzung der biologischen Vielfalt ist Voraussetzung zur Bewältigung der globalen Biodiversitätskrise - Weltbiodiversitätsrat verabschiedet in Bonn zwei neue Berichte
11.07.2022
Wie kann der Mensch wildlebende Arten nachhaltig nutzen? Welche unterschiedlichen Wertvorstellungen haben Menschen von der Natur? Zwei Berichte des Weltbiodiversitätsrates IPBES geben der Politik wichtige Empfehlungen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der globalen biologischen Vielfalt an die Hand. Sie zeigen, dass die Übernutzung wildlebender Arten eine weltweite Bedrohung darstellt. Eine bessere Berücksichtigung der vielfältigen Werte der Natur kann dazu beitragen, die Biodiversitätskrise zu stoppen. Bei den Verhandlungen in Bonn wurde außerdem ein neuer Bericht auf den Weg gebracht, der sich mit den Zusammenhängen zwischen Wirtschaft und Biodiversität auseinandersetzen wird.
mauritius images / Alamy / blickwinkel
Mikroben helfen bei der Anpassung an den Klimawandel
04.07.2022
Alle vielzelligen Lebewesen sind von einer unvorstellbar großen Anzahl von Mikroorganismen besiedelt und haben sich in der Entstehungsgeschichte des Lebens von Beginn an gemeinsam mit ihnen entwickelt. Das natürliche Mikrobiom, also die Gesamtheit dieser Bakterien, Viren und Pilze, die in und auf einem Körper leben, ist von fundamentaler Bedeutung für den Gesamtorganismus. Forschende aus Kiel und Düsseldorf untersuchen nun am Beispiel der Seeanemone Nematostella vectensis den Beitrag des Mikrobioms zur Temperaturanpassung von Lebewesen. Die Forschenden konnten zeigen, dass sich die Bakterienbesiedlung der Tiere infolge der Akklimatisierung ändert und deren Organismus zudem resistenter gegenüber Hitzestress wird. Zusätzlich gelang es ihnen, einen ursächlichen Zusammenhang zu belegen: Übertrugen sie das Mikrobiom der wärmeangepassten auf nicht akklimatisierte Anemonen, wurden auch diese unempfindlicher gegenüber höheren Temperaturen.
Mehr Informationen: Uni Kiel: Mikroben helfen bei der Anpassung an den Klimawandel (uni-kiel.de)
Schadstoffe gefährden heimische Fledermäuse
13.06.2022
Fledermäuse wurden in Europa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer seltener. Gründe dafür sind auch die Belastung mit Schwermetallen und schwer abbaubaren organischen Schadstoffen. Das zeigt eine aktuelle Studie zu den Beständen der kleinen Hufeisennase im Bayerisch-Tiroler Alpenraum unter der Leitung der Universität Innsbruck. Urbanisierung und Verlust von Laubwäldern engen den Lebensraum der Fledermäuse zusätzlich ein.
Mehr Informationen: https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2022/schadstoffe-gefahrden-heimische-fledermause/

Wohl dem, der Wärme liebt
03.06.2022
Wie sich der fortschreitende Klimawandel auf die Bestände heimischer Tierarten auswirkt, ist aufgrund lückenhafter Datensätze oft schwer zu verfolgen. In einer neuen Studie der Technischen Universität München (TUM) und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) wurde nun das umfangreiche Datenbanksystem der Artenschutzkartierung (ASK) des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) zum Vorkommen von Schmetterlingen, Libellen und Heuschrecken in Bayern seit 1980 ausgewertet. Das Ergebnis: Wärmeliebende Arten zeigen positive Trends.
Mehr Informationen: https://www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/37448

Bild: E. K. Engelhardt / TUM
Neue Studie zur Anpassungsfähigkeit von großen Korallenriffen an die Klimaerwärmung
25.05.2022
Eine neue Studie des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) berechnet anhand eines Modells und von Daten aus dem Feld, inwieweit große Riffe wie das Great Barrier Reef vor der australischen Küste in der Lage sein werden, sich auf lange Sicht der Ozeanerwärmung anzupassen.
Mehr Informationen: Neue Studie zur Anpassungsfähigkeit von großen Korallenriffen an die Klimaerwärmung (leibniz-zmt.de)

Kulturlandschaft als Hotspot der Artenvielfalt: Projekt Teichlausitz forscht zum Erhalt der Lausitzer Teichlandschaften
12.05.2022
In manchen Gebieten ist es das Beste, die Natur sich selbst zu überlassen. Der Artenvielfalt in ökologisch wertvollen mitteleuropäischen Kulturlandschaften kann genau das zum Verhängnis werden – ohne den Erhalt traditioneller Bewirtschaftungsformen ist ihr Überleben gefährdet. So auch in den Teichlandschaften der Lausitz in Sachsen und Brandenburg, in denen seit etwa 800 Jahren Karpfen und andere Fische gezüchtet werden. Die einst künstlich angelegten Teiche haben sich längst zu einem Eldorado des Artenschutzes entwickelt. Neben ihrer Rolle als Lebensräume für Fischotter und Co. spielen sie auch für den Wasserhaushalt, den Tourismus und für das Lokalklima eine entscheidende Rolle.
Mehr Informationen: Kulturlandschaft als Hotspot der Artenvielfalt: Projekt TeichLausitz forscht zum Erhalt der Lausitzer Teichlandschaften — TU Dresden — TU Dresden (tu-dresden.de)

(Bild: IHI Zittau)
Wie wirkt sich Wiederaufforstung auf den Wasserkreislauf aus?
12.05.2022
Wie würden sich Aufforstung und Renaturierung großer Flächen weltweit auf die Wasserströme auswirken? Eine neue Studie unter der Leitung der Wissenschaftlerin Anne Hoek van Dijke von der Universität Wageningen und unter Mitwirkung von Martin Herold vom GFZ liefert interessante Antworten. Die Auswirkungen auf die Niederschläge reichen demnach weit über Ländergrenzen und sogar Kontinente hinaus: So kann die Wiederaufforstung von Bäumen im Amazonasgebiet zum Beispiel Niederschläge in Europa und Ostasien beeinflussen. In der Studie, die am 11. Mai 2022 in Nature Geoscience veröffentlicht wurde, wurden die globalen Auswirkungen einer groß angelegten Baumsanierung auf die Wasserflüsse und die Wasserverfügbarkeit berechnet.
Mehr Informationen: Wie wirkt sich Wiederaufforstung auf den Wasserkreislauf aus?: GFZ (gfz-potsdam.de)

(Bild: GFZ)
Artenschutz für Pilze
12.05.2022
Eines vorweg: Es geht nicht um die großen Speisepilze, sondern um die mikroskopisch kleinen Vertreter im Wasser. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des IGB plädiert dafür, diese besser zu schützen. Das klingt unbedeutend und schwer umsetzbar, ist es aber beides nicht. Das große Reich der Pilze fristet ein Schattendasein neben den beiden anderen Reichen eukaryotischer Lebewesen – den Pflanzen und Tieren. Dabei gäbe es ohne die Pilze kein Penicillin, kein Bier und keinen Hefezopf. Ähnlich eines Verdauungsapparats befördern sie im Wasser die Zersetzung von Stoffen und sind zugleich Nahrung für Tiere. Bedroht sind aquatische Pilze beispielsweise durch eingespülte Fungizide, die sie eigentlich gar nicht bekämpfen sollen. Um Pilze zu schützen, wären Bioassays und ein besseres Monitoring sinnvoll.
Mehr Informationen: Artenschutz für Pilze | IGB (igb-berlin.de)
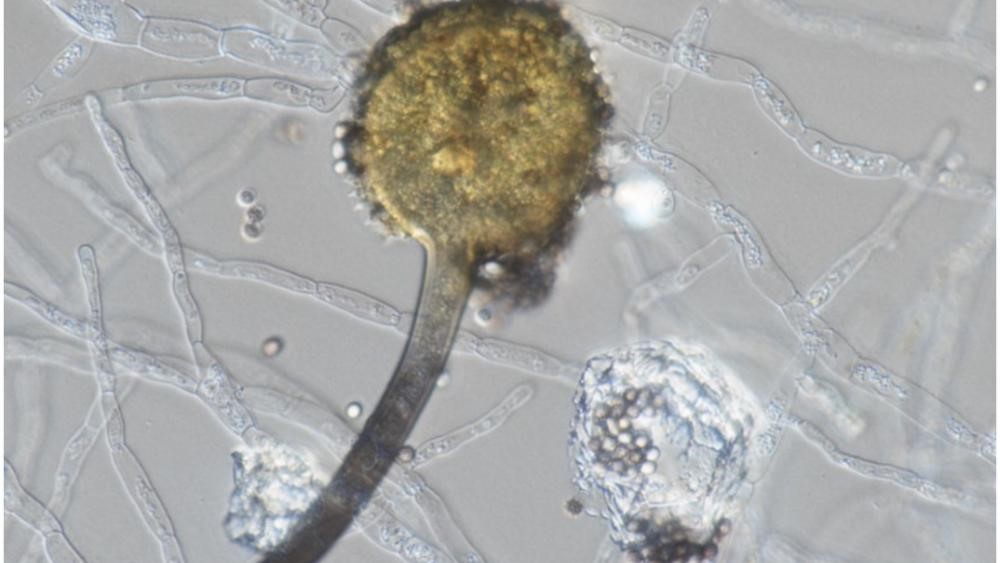
Bild: H. Masigol
Fleischalternativen aus Pilzkulturen könnten helfen, die Wälder der Erde zu retten
04.05.2022Wenn bis 2050 nur ein Fünftel des pro-Kopf Rindfleischkonsums durch Fleischalternativen aus mikrobiellem Protein ersetzt wird, könnte das die weltweite Entwaldung halbieren: Das ist das Ergebnis einer neuen Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde und zum ersten Mal mögliche Auswirkungen dieser bereits marktreifen Lebensmittel auf die Umwelt umfassend untersucht. Der aus Pilzkulturen durch Fermentierung produzierte Fleischersatz ähnelt echtem Fleisch in Geschmack und Konsistenz, ist aber ein biotechnologisches Produkt. Gegenüber Rindfleisch erfordern diese Fleischalternativen deutlich weniger Landressourcen und können somit die Treibhausgasemissionen durch Viehhaltung und die Ausweitung von Acker- und Weideland stark senken. Die Analyse geht von der Annahme aus, dass die wachsende Weltbevölkerung immer mehr Appetit auf Rindfleisch hat.
Mehr Informationen: Fleischalternativen aus Pilzkulturen könnten helfen, die Wälder der Erde zu retten — Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (pik-potsdam.de)

Wie sich Oktopusse und Tintenfische vom bisher bekannten Muster der Evolution gelöst haben
04.05.2022Ihre Tarnungsfähigkeit, ihr höchst interaktives Verhalten sind einzigartig im Tierreich – Oktopusse und andere Tintenfische sind komplexe Lebewesen. Die Chromosomen von Kopffüßern unterscheiden sich stark von denen jeder anderen Tiergruppe. Die Entschlüsselung der Genome von Kopffüßern spielt eine zentrale Rolle, um diese Tiere besser zu verstehen.
Mehr Informationen: Wie sich Oktopusse und Tintenfische vom bisher bekannten Muster der Evolution gelöst haben (univie.ac.at)

(Bild: Tom Kleindinst, Marine Biological Laboratory)
Wie Millionen von Gärten in Deutschland zum Schutz von biologischer Vielfalt beitragen können - Forschungsprojekt gARTENreich will Artenreichtum in Privatgärten erhöhen
02.05.2022Gärten können eine wichtige Rolle dabei spielen, das Artensterben aufzuhalten: Schätzungen zufolge gibt es 17 Millionen Gärten in Deutschland, eine riesige Anzahl kleiner Lebensräume. Bislang ist die biologische Vielfalt in Gärten vielerorts allerdings niedrig und hat in den letzten Jahren sogar abgenommen. Das Projekt gARTENreich möchte darauf hinwirken, dass sich dies ändert. Um zu erforschen, wie Gärten zum Erhalt der Biodiversität in Deutschland beitragen können, und um mit diesem Wissen die biologische Vielfalt in Gärten zu fördern, arbeiten mehrere Institutionen aus Wissenschaft und Praxis mit kommunalen Partnerinnen zusammen.

Süße Oasen im Meer: Unter Seegraswiesen liegt haufenweise Zucker
02.05.2022Seegraswiesen gehören zu den am stärksten bedrohten Lebensräumen unseres Planeten. Seegräser entfernen sehr effizient Kohlendioxid aus der Atmosphäre: Ein Quadratkilometer Seegras speichert fast doppelt so viel Kohlenstoff wie Wälder an Land, und das 35-mal so schnell. Jetzt haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in Bremen herausgefunden, dass Seegräser sehr viel Zucker in ihre Böden, die sogenannte Rhizosphäre, abgeben. Die Konzentration von Zucker unter dem Seegras war mindestens 80-mal so hoch wie alles, was bisher im Meer gemessen wurde.
Mehr Informationen: Süße Oasen im Meer: Unter Seegraswiesen liegt haufenweise Zucker (mpi-bremen.de)
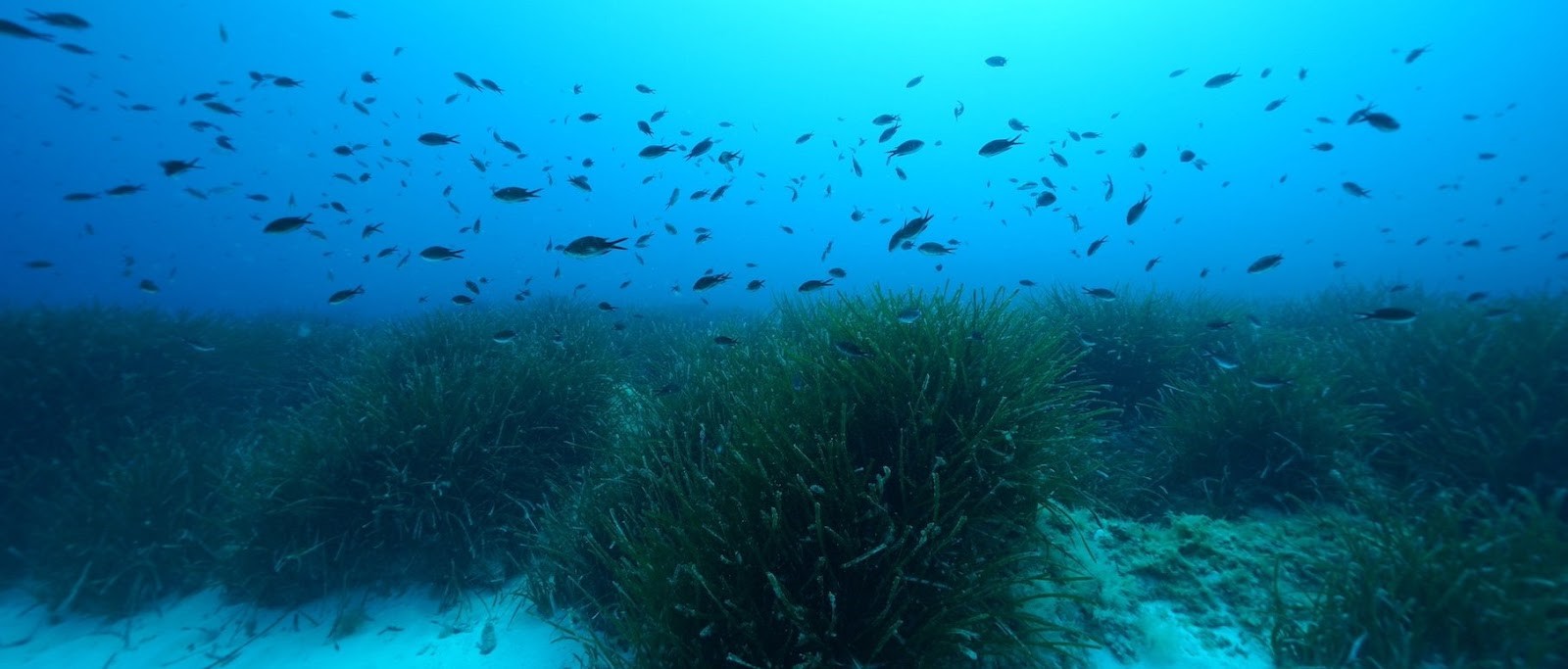
(Bild: HYDRA Marine Sciences GmbH)
Arten schützen fürs Weltklima
26.04.2022Maßnahmen für den Klimaschutz sowie für den Schutz der Biodiversität wurden bislang oft parallel zueinander entwickelt. Doch dies gilt mittlerweile als überholt, da viele Ansätze sowohl das Klima als auch die Artenvielfalt schützen können. Vor dem Hintergrund der anstehenden UN-Artenschutzkonferenz hat ein internationales Team von Wissenschaftler:innen die Rolle der künftigen globalen Biodiversitätsziele (Post-2020 Action targets for 2030) für den Klimaschutz bewertet und dabei festgestellt, dass immerhin zwei Drittel der globalen Biodiversitätsziele auch helfen können, den Klimawandel zu bremsen.
Mehr Informationen: Presse - Arten schützen fürs Weltklima (ufz.de)

(Bild: André Künzelmann / UFZ)
Bohnenanbau in vielfältigen Agrarlandschaften fördert Bienen und steigert Ertrag
14.04.2022Bestäubung durch Insekten ist essenziell für die Produktion vieler Nahrungspflanzen. Das Vorkommen von Bestäubern wie Bienen ist davon abhängig, ob Nistplätze und ausreichend Nahrung vorhanden sind. Fehlen diese Voraussetzungen, bleiben auch die Bestäuber aus und es leidet der Ertrag von blühenden Ackerkulturen, wie zum Beispiel Ackerbohnen und Raps. Ein Team der Universität Göttingen und des Julius Kühn-Instituts (JKI) in Braunschweig hat untersucht, wie sich die Landschaftszusammensetzung aus blühenden Kulturen und naturnahen Habitaten auf die Dichten von Bienen, deren Verhalten beim Sammeln von Nektar und die Erträge von Ackerbohnen (Vicia faba L.) auswirkt.
Mehr Informationen: Presseinformationen - Georg-August-Universität Göttingen (uni-goettingen.de)

(Bild: Nicole Beyer)
Biologische Vielfalt könnte helfen, Umweltveränderungen abzufedern
31.03.2022
Die Biodiversität verändert sich und damit auch die Ökosystemfunktionen. Ein wichtiger Zusammenhang, doch es ist nach wie vor schwierig, komplexe Wechselwirkungen in natürlichen Ökosystemen zu entschlüsseln.Ein Forschungsteam analysierte Langzeitdaten zum Phytoplankton aus 19 ganz unterschiedlichen aquatischen Ökosystemen, um die kausalen Verbindungen und komplexen Rückkopplungen zwischen Biodiversität, Ökosystemfunktionen und Umweltfaktoren zu verstehen.
Mehr Information: Biologische Vielfalt könnte helfen, Umweltveränderungen abzufedern | IGB (igb-berlin.de)

(Bild: Michael Feierabend)
Ein einziges Gen steuert die Artenvielfalt in einem Ökosystem
31.03.2022
Ein einzelnes Gen kann ein ganzes Ökosystem beeinflussen. Das zeigt ein Forscherteam der Universität Zürich in einem Laborexperiment mit einer Pflanze und dem dazugehörigen Ökosystem von Insekten. So fördern Pflanzen mit einer Mutation in einem bestimmten Gen Ökosysteme mit mehr Insektenarten. Die Entdeckung eines solchen «Schlüsselgens» könnte die derzeitigen Strategien zur Erhaltung der biologischen Vielfalt verändern.
Mehr Information: UZH - Media - Ein einziges Gen steuert die Artenvielfalt in einem Ökosystem

(Bild: Matthias Furler)
Biologische Vielfalt als Lebensgrundlage retten und fördern
Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität legt konkrete Empfehlungen für Politik und Gesellschaft vor.
16.03.2022
45 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Forschungsnetzwerks Biodiversität sowie Kolleginnen und Kollegen haben eine Bestandsaufnahme zum Erhalt der Natur als Lebensgrundlage des Menschen vorgelegt. Die „10 Must-Knows aus der Biodiversitätsforschung“ sollen im Vorfeld der Weltbiodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen im chinesischen Kunming zum Dialog einladen, formulieren aber gleichzeitig konkrete Empfehlungen für Politik und Gesellschaft.
Mehr Informationen: Biologische Vielfalt als Lebensgrundlage retten und fördern (leibniz-gemeinschaft.de)

Bundesweiter Pflanzwettbewerb 2022 - Bühne frei für Ihren Wildbienen-Garten!
04.03.2022
Es geht wieder los! Jetzt ist die Zeit, den nächsten Pflanzwettbewerb vorzubereiten: Blüh- und Pflanzpläne erstellen, Saat bestellen und Material für Strukturen sammeln. Um die Biodiversität lokal zu fördern ist das Anlegen von Blühgärten und natürlichen Strukturen (Totholz, Steine...) sinnvoll. Im bundesweiten Pflanzwettbewerb können Pflanzaktionen dokumentiert und bis zum 31. Juli eingereicht werden. Für die besten Beiträge winken Geldpreise bis 400,- Euro und eine Einladung zur Prämierungsfeier in Berlin.
Mehr Informationen: https://wir-tun-was-fuer-bienen.de/home.html
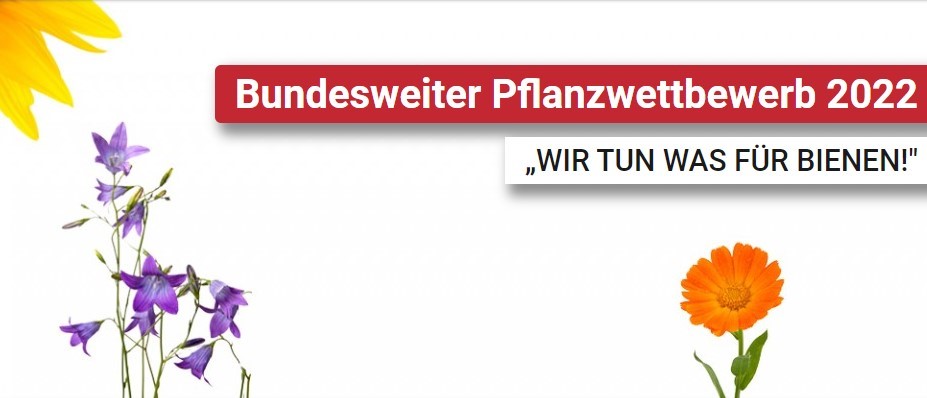
Ameisen zeigen an, wie sich der Regenwald erholt
04.03.2022
Kann sich zerstörter Regenwald wieder regenerieren? Daran forscht das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Konsortium „Reassembly“ unter Leitung der TU Darmstadt. Am Beispiel von Ameisen lässt sich dabei beurteilen, ob und wie gut sich Regenwald nach einer landwirtschaftlichen Nutzung wiederherstellen lässt.
Mehr Informationen: Ameisen zeigen an, wie sich der Regenwald erholt – TU Darmstadt (tu-darmstadt.de)

Tarnung oder Kommunikation: Wozu Vögel ihren Geruch nutzen
23.02.2022
Welche Sinne nutzen Vögel? Offensichtlich gebrauchen sie Gehör und Augen – schließlich singen sie und tragen oft ein buntes Gefieder. Was aber ist mit dem Geruchssinn? Lange Zeit gab es die Ansicht, Riechen spiele für Vögel keine Rolle. In den vergangenen Jahren ist aber eine Reihe von Arbeiten entstanden, die diese Annahme widerlegen – darunter Forschungen, die sich mit dem Sekret aus der Bürzeldrüse befassen, mit dem Vögel sich mehrmals am Tag ihr Gefieder einschmieren. Was es mit Veränderungen in dessen Zusammensetzung auf sich haben könnte und welche Rolle der Geruch dabei spielt, haben Wissenschaftler*innen unter anderem der Universität Bielefeld untersucht.
Mehr Informationen: Pressemitteilungen: Tarnung oder Kommunikation: Wozu Vögel ihren Geruch nutzen (Nr. 15/2022) (uni-bielefeld.de)

Hoch aus der Luft helfen Drohnen, den Lebensraum von Zauneidechsen zu erfassen
22.02.2022
Die Raumnutzung und Lebensraumbedürfnisse von Tieren zu verstehen ist wesentlich für einen wirksamen Artenschutz. Kleine Tiere nutzen kleine, schwer zu erfassende Strukturen. LIB-Forschende haben in einer aktuellen Studie diese kleinen Strukturen mit Hilfe von Drohnen in hochauflösenden Habitatkarten dargestellt. Das Team konnte zeigen, wie wichtig niedrige Brombeerbüsche für Zauneidechsen in der Dellbrücker Heide in Köln sind. Die Drohnen-Methode kann Anwendung im Naturschutz finden.
Mehr Informationen: Hoch aus der Luft helfen Drohnen, den Lebensraum von Zauneidechsen zu erfassen – LIB (leibniz-lib.de)

(Bild: Vic Clement)
Nachhaltige Zukunft für die Küstenfischerei an der Ostsee
Projekt SpaCeParti setzt auf Reallabore für die Lösung von Nutzungskonflikten
21.02.2022
In der westlichen Ostsee ist die Küstenfischerei eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Küstengemeinden und den Auswirkungen des Klimawandels mit dem zunehmenden Verlust von Biodiversität verknüpft. Für eine nachhaltige Zukunft der Fischerei müssen vielfältige Interessen berücksichtigt werden. Dazu gehören auch Raum- und Ressourcenkonflikte, die zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen erkannt und im gemeinsamen Dialog gelöst werden müssen. Dazu beitragen will das vom Center for Ocean and Society an der Universität Kiel koordinierte Projekt SpaCeParti mit der Einrichtung von sogenannten Reallaboren, in die Nutzerinnen und Nutzer aktiv in die Forschung einbezogen werden.
Mehr Informationen:
Uni Kiel: Nachhaltige Zukunft für die Küstenfischerei an der Ostsee (uni-kiel.de)

(Bild: Kilian Etter und Svenja Karstens, CeOS/Uni Kiel)
Afrikas Rolle im Weltbiodiversitätsrat IPBES stärken
18.02.2022
Das Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn erhält für die kommenden acht Jahre rund acht Millionen Euro Fördermittel von der Internationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Das neue Projekt CABES (Capacities on Biodiversity and Ecosystem Services) soll die Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis in Afrika stärken und die Vernetzung mit den internationalen Aktivitäten des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) unterstützen. Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, Nachwuchsforschende als Vermittlerinnen und Vermittler auszubilden. Dazu entstehen neue Masterstudiengänge in der Republik Côte d’Ivoire, Äthiopien und der Demokratischen Republik Kongo.
Mehr Informationen: Afrikas Rolle im Weltbiodiversitätsrat IPBES stärken — Universität Bonn (uni-bonn.de)

(Bild: ZEF/ Jan Henning Sommer)
Wo wilde Honigbienen überleben
16.02.2022
Bis vor kurzem hielt es die Fachwelt für unwahrscheinlich, dass die Honigbiene in Europa bis heute als Wildtier überlebt hat. Doch inzwischen konnten die Biologen Benjamin Rutschmann und Patrick Kohl von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) nachweisen, dass es in der Region Galicien im Nordwesten von Spanien noch wilde Honigbienen gibt. Die wilden Honigbienen nutzen hohle Strommasten als Nisthöhlen. Sie können dort den Winter umso besser überleben, je mehr naturnahe Areale die Umgebung bietet.
Mehr Informationen: Wo wilde Honigbienen überleben - Universität Würzburg (uni-wuerzburg.de)

(Bild: Dimi Dumortier)
Beispiel Mainmetropole: Wie Städte zum Erhalt der Insektenvielfalt beitragen können
16.02.2022
Während das Insektensterben in Wald, Feldern und Naturschutzgebieten voranschreitet, stellen Städte zunehmend geeignete Habitate für Insekten dar. Für den Erhalt ihrer Vielfalt ist deshalb auch die Stadtgesellschaft gefragt, denn ihr Verhalten hat Einfluss auf die Biodiversität von Libellen, Hummeln und Artverwandten. Am Beispiel der Mainmetropole untersuchen Frankfurter Forschungs- und Praxispartner unter der Leitung des ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung erstmals den Zusammenhang zwischen städtischen Lebensstilen, Alltagspraktiken und Insektendiversität. Das Forschungsprojekt SLInBio wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Mehr Informationen: Beispiel Mainmetropole: Wie Städte zum Erhalt der Insektenvielfalt beitragen können: ISOE

Vergessene Arten sterben zweimal aus
15.02.2022
Die Biodiversitätskonferenz hat das Ziel anvisiert, bis 2030 mindestens 30% der Land- und Meeresflächen und ihres Artenreichtums unter Schutz zu stellen. OECMs sind alternative Schutzformen, die entscheidend sein könnten, um zusätzlich zu Naturschutzgebieten die Vielfalt der Arten unseres Planeten zu erhalten. Eine neue Studie mit Beteiligung des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) hat Küsten- und Meeresgebiete in Indonesien erfasst, die als OECMs anerkannt werden könnten. Die Studie soll der indonesischen Regierung als Entscheidungsgrundlage dienen.
Mehr Informationen: Vergessene Arten sterben zweimal aus | IGB (igb-berlin.de)

(Bild: Tomasz Chmielewski)
OECMs: neues Instrument zum Schutz der Biodiversität
09.02.2022
Die Biodiversitätskonferenz hat das Ziel anvisiert, bis 2030 mindestens 30% der Land- und Meeresflächen und ihres Artenreichtums unter Schutz zu stellen. OECMs sind alternative Schutzformen, die entscheidend sein könnten, um zusätzlich zu Naturschutzgebieten die Vielfalt der Arten unseres Planeten zu erhalten. Eine neue Studie mit Beteiligung des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) hat Küsten- und Meeresgebiete in Indonesien erfasst, die als OECMs anerkannt werden könnten. Die Studie soll der indonesischen Regierung als Entscheidungsgrundlage dienen.
Mehr Informationen: OECMs: neues Instrument zum Schutz der Biodiversität (leibniz-zmt.de)

(Bild: Stevanus Roni)
Invasive Arten: Vorsorge könnte weltweit eine Billion Euro einsparen
09.02.2022
Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Philip Haubrock hat gemeinsam mit Forschenden aus 17 internationalen Institutionen untersucht, welche Kosten durch invasive Arten entstehen und wie diese verhindert werden könnten. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass die Kosten von Schäden, die durch invasive Arten verursacht wurden, mindestens zehnmal so hoch sind wie die Ausgaben, die für ihre Bekämpfung notwendig wären. Durch Vorsorgemanagement könnten laut der heute im Fachjournal „Science of the Total Environment“ erscheinenden Studie weltweit eine Billion Euro eingespart werden.
Mehr Informationen: Invasive Arten: Vorsorge könnte weltweit eine Billion Euro einsparen | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Wikimedia Commons)
Gentechnik kann sich positiv aufs Klima auswirken
08.02.2022
Gentechnisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft stehen vor allem in Europa in der Kritik – laut Umfragen befürchten viele Menschen negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Eine neue Studie zeigt allerdings, dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen positiv auf die Umwelt und vor allem das Klima auswirken könnten. Die Ergebnisse belegen, dass der Einsatz solcher Pflanzen in Europa den Ausstoß schädlicher Treibhausgase erheblich reduzieren würde. Die Studie von Forschenden des Breakthrough-Instituts in den USA und der Universität Bonn ist in der Fachzeitschrift “Trends in Plant Science” erschienen.
Mehr Informationen: Gentechnik kann sich positiv aufs Klima auswirken — Universität Bonn (uni-bonn.de)

(Bild: ZEF/Uni Bonn)
Üppige Schwammgärten auf Untersee-Bergen in der arktischen Tiefsee entdeckt
08.02.2022Auf den Gipfeln von Seebergen im zentralen Arktischen Ozean, einem der nährstoffärmsten Meere der Erde, gedeihen riesige Schwammgärten. Die Schwämme ernähren sich scheinbar von den Überresten ausgestorbener Tiere. Mikroorganismen helfen ihnen dabei, dieses Material als Nahrungs- und Energiequelle zu nutzen. Forschende aus Bremen, Bremerhaven und Kiel sowie ihre internationalen Partner entdeckten diesen einzigartigen Hotspot des Lebens während einer POLARSTERN-Expedition und berichten nun in der Fachzeitschrift Nature Communications über ihre Erkenntnisse. Es ist unerlässlich, die Vielfalt und Einzigartigkeit der arktischen Ökosysteme besser zu verstehen, gerade vor dem Hintergrund globaler und lokaler Veränderungen, betonen die Forschenden.
Mehr Informationen: Üppige Schwammgärten auf Untersee-Bergen in der arktischen Tiefsee entdeckt (mpi-bremen.de)

(Bild: Alfred-Wegener-Institut/PS101 AWI OFOS System)
7 bis 9 Prozent aller europäischen Gefäßpflanzen im weltweiten Fortbestand gefährdet
07.02.2022
Sieben bis neun Prozent aller in Europa vorkommenden Gefäßpflanzenarten sind in ihrem weltweiten Fortbestand gefährdet. Das ist das Ergebnis einer Studie unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Leipzig. Die Forschenden kombinierten Rote Listen gefährdeter Pflanzenarten in Europa mit Daten ihrer weltweiten Verbreitung. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Plants, People, Planet veröffentlicht worden. Die Arbeit hilft, das Gesamt-Gefährdungsrisiko von Pflanzenarten einzuschätzen und unterstützt so die Grundlage internationaler Naturschutzaktivitäten.
Mehr Informationen: News single view (idiv.de)

(Bild: Vlaev, Dimiter in Peev, D. et al. (eds) (2015): Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi. MoEW & BAS, Sofia [Single inset drawings; compiled by Staude, I.]. http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/)
Tiefsee-Leben: Erst ein Drittel bekannt
07.02.2022
Analyse von DNA-Sequenzen zeigt erstmalig eine Übersicht der biologischen Vielfalt in den Weltmeeren. Ein internationales Forschungsteam hat zwei Milliarden DNA-Sequenzen von 15 internationalen Tiefsee-Expeditionen ausgewertet. Sie zeigen in ihrer im Fachjournal „Science Advances“ erschienenen Studie, dass fast zwei Drittel der auf dem Meeresboden lebenden Organismen keiner bislang bekannten Gruppe zugeordnet werden können. Zudem geben die Daten Aufschluss darüber, welchen Einfluss diese Ökosysteme auf das globale Klima haben.
Mehr Informationen: Tiefsee-Leben: Erst ein Drittel bekannt | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Thomas Walter)
Landnutzung gefährdet Biodiversität weltweit
04.02.2022
Land- und Forstwirtschaft sowie Infrastruktur beeinflussen, verändern oder zerstören natürliche Lebensräume. Konsequenzen für die Biodiversität werden meist auf Basis der durch Landnutzung beanspruchten Fläche berechnet. Aber auch die Intensität der Nutzung spielt eine Rolle, zeigt eine neue Studie von Philipp Semenchuk und Kolleg*innen der Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums Frankfurt. Die Gefährdung von Landwirbeltieren lässt sich zu etwa 25 Prozent auf die Intensität der Nutzung zurückführen.
Mehr Informationen:
Landnutzung gefährdet Biodiversität weltweit (univie.ac.at)

(Bild: Helmut Haberl)
Laien gesucht zum Meerechsen-Zählen auf Galápagos
04.02.2022
Ein Forscherteam der Universität Leipzig hat in den vergangenen Wochen auf den Galápagos-Inseln mit Drohnen Luftbilder von Meerechsen aufgenommen. „Iguanas from Above“ heißt die Kampagne. Die Forschenden zählen nun auf den Luftbildern den Bestand dieser vom Aussterben bedrohten Leguan-Art, die nur auf dem Archipel im östlichen Pazifik natürlich vorkommt. Außerdem sammelten sie Blut- und Hautproben von Leguanen sowie Algen aus ihrem Lebensraum, um mehr Erkenntnisse über deren Ernährung zu bekommen. Anfang Februar hat ebenfalls auf den Galápagos-Inseln ein zweites Projekt im Rahmen dieser Kampagne begonnen: Bei diesem Citizen-Science-Projekt werden Laien gesucht, die Leguane auf Fotos zählen, damit Daten schneller ausgewertet werden können. Per Foto-Zählung wird auch die Menge des Plastikmülls auf den Inseln und im Meer erfasst, der eine große Gefahr nicht nur für die Meerechsen darstellt.
Mehr Informationen:
Universität Leipzig: Laien gesucht zum Meerechsen-Zählen auf Galápagos (uni-leipzig.de)

(Bild: Dr. Amy MacLeod)
Landnutzung gefährdet Biodiversität weltweit
04.02.2022
Große Landflächen radikal für Tiere und Pflanzen reservieren – das könnte die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten vor einem Kollaps der Artenvielfalt bewahren. Doch in einigen Ländern, insbesondere des globalen Südens, könnte das die Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährden. Auf diesen Zielkonflikt machen jetzt Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit Partnern aus Großbritannien und Österreich in einer Studie in der Fachzeitschrift Nature Sustainability aufmerksam und plädieren für ein umsichtiges Vorgehen.
Mehr Informationen:

(Bild: Markus Breig, KIT)
Neue Schätzung der Anzahl an Baumarten auf der Erde
01.02.2022
Wie viele Arten die Erde bevölkern, ist eine der grundlegendsten Fragen der Ökologie. Nun haben Forschende aus aller Welt unter Beteiligung von Martin Herold vom Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) im Fachmagazin PNAS ihre Daten zusammengetragen und eine neue Schätzung für die Anzahl der Baumarten vorgelegt – auf biologischer, kontinentaler und globaler Skala. Den neuen Schätzungen zufolge gibt es auf der Erde rund 73.300 Baumarten, 14 Prozent mehr als bislang angenommen. Etwa 9.000 davon müssten noch entdeckt werden, 40 Prozent davon – so die Erwartung der Forschenden – in Südamerika. Die Schätzung der Anzahl der Baumarten ist von grundlegener Bedeutung für unser Verständnis vom Funktionieren von Ökosystemen und für die Optimierung und Priorisierung von Waldschutzmaßnahmen auf der ganzen Welt.
Mehr Informationen:
Neue Schätzung der Anzahl an Baumarten auf der Erde (gfz-potsdam.de)
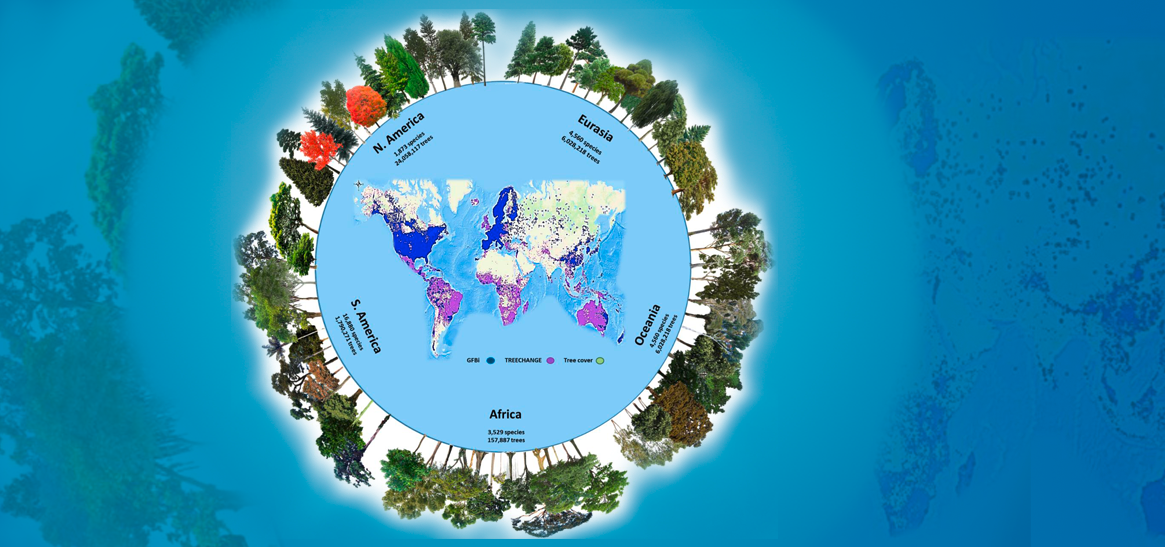
(Bild: Cazzolla Giatti)
Mitteleuropa: Die Zukunft der Luchse
26.01.2022
Wissenschaftler*innen von Senckenberg und vom LOEWE-Zentrum für Translationale Biodiversitätsgenomik haben mit einem internationalen Team die genetische Vielfalt von Luchsen in Europa untersucht. In ihrer heute im Fachjournal „Biological Conservation“ erschienenen Studie zeigen sie, dass die genetische Vielfalt in den Populationen wiederangesiedelter Luchse über die Jahre stark abgenommen hat. Die Forschenden warnen, dass dieser Verlust, zusammen mit den teils deutlich erhöhten Inzuchtwerten, in einigen Beständen den Erhalt der seltenen Art langfristig gefährden könnte. Zudem zeigen sie in ihrer Arbeit welche Faktoren für stabile und gesunde Luchspopulationen in Europa notwendig sind.
Mehr Informationen:
Mitteleuropa: Die Zukunft der Luchse | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Christine Breitenmoser/KORA)
Weltweit Schutzgebiete unter die Lupe genommen
25.01.2022
Schutzgebiete gehören zu den effektivsten Mitteln, um die biologische Vielfalt zu erhalten. Allerdings werden neue Schutzgebiete oft eingerichtet, ohne bereits bestehende Reservate zu berücksichtigen. Dies kann zu einer Überrepräsentation bestimmter biophysikalischer Eigenschaften wie Temperatur oder Topografie führen, die ein bestimmtes Gebiet ausmachen. Eine Forschungsgruppe an der Technischen Universität München (TUM) hat nun in einer globalen Analyse bewertet, welchen Schutzumfang verschiedene biophysikalische Bedingungen haben.
Mehr Informationen:
Weltweit Schutzgebiete unter die Lupe genommen - TUM
(Bild: Ch. Hof / TUM)
Forschung für die europäische Artenvielfalt
25.01.2022
Um die Artenvielfalt Europas zu erforschen und wichtige genomische Daten dafür bereitzustellen, initiierten Wissenschaftler*innen aus 48 Ländern Anfang 2021 den „Europäischen Referenz-Genom-Atlas“ (ERGA). Im Rahmen dieses Projekts erstellen die rund 600 beteiligten Forscher*innen besonders hochwertige Genomanalysen, sogenannte Referenzgenome, zur biologischen Vielfalt des europäischen Kontinents. Etwa 200.000 Arten haben sie dabei im Blick. Zu den untersuchten Organismen zählen bedrohte Arten wie auch solche, die für Landwirtschaft, Fischerei, Schädlingsbekämpfung und für die Funktion und Stabilität von Ökosystemen wichtig sind. Dennoch sind bisher nur für einen kleinen Teil der europäischen Arten Genome in Referenzqualität verfügbar.
Mehr Informationen:
Forschung für die europäische Artenvielfalt | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Clément Schneider)
Neue Wege für die Bewirtschaftung wiedervernässter Moorböden in Brandenburgs Luchgebieten
22.01.2022
Innovative Lösungen zur Bewirtschaftung wiedervernässter Flächen stehen im Fokus eines Anfang 2022 gestarteten Projekts, das den Transformationsprozess der Landnutzung auf nassen Mooren zum Klimaschutz voranbringen soll. Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie wird dabei Lösungen für regionale Wertschöpfungsketten erarbeiten, u.a. im Bereich von Fasern für Papierprodukte, Dämmstoffe oder Torfersatzstoffe.
Mehr Informationen:
ATB: Neue Wege für die Bewirtschaftung wiedervernässter Moorböden in Brandenburgs Luchgebieten (atb-potsdam.de)

(Bild: Carsten Lühr/ATB)
Mikroalgen im Wattenmeer sind in den letzten Jahren geschrumpft
20.01.2022
Das Zellvolumen von Mikroalgen im niedersächsischen Wattenmeer hat sich zwischen 2006 und 2019 um 30 Prozent verringert. Insbesondere Kieselalgen, so genannte Diatomeen, waren von dieser Schrumpfung betroffen. Das berichtet ein Team um den Biodiversitätsexperten Prof. Dr. Helmut Hillebrand vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Universität Oldenburg in der Fachzeitschrift Limnology and Oceanography. Der langjährige Trend könnte dem Team zufolge auf steigende Temperaturen und einen sinkenden Gehalt des Nährstoffs Phosphor in der Nordsee zurückgehen. Die abnehmende Zellgröße der einzelligen Algen könne ein Indikator für Veränderungen in der Lebensgemeinschaft insgesamt sein, so die Forschenden.
Mehr Informationen:
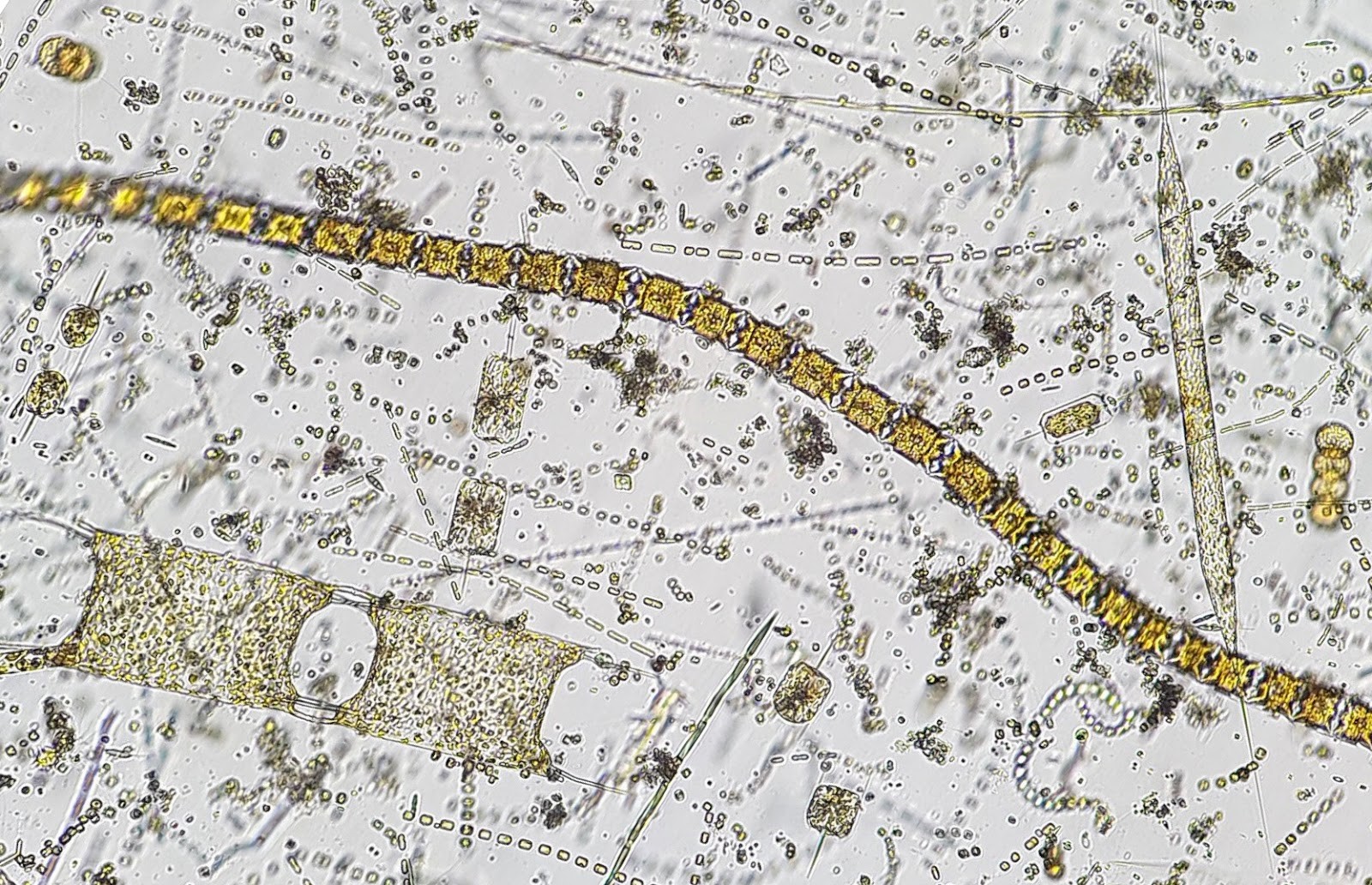
(Bild: Universität Oldenburg/Patrick Thomas)
Was führt zu einer schnellen Artenaufspaltung in Korallenriffen?
19.01.2022
Eine Arbeitsgruppe um Oscar Puebla, Meereswissenschaftler am Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) und Professor für Fischökologie und -evolution am Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) der Universität Oldenburg, nahm sich die Hamletbarsche vor, um Einblicke in die zugrundeliegenden Mechanismen einer schnellen Artenaufspaltung in Korallenriffen zu bekommen, einem sehr komplexen Lebensraum. Dazu analysierten die Wissenschaftler die Genome von 170 Individuen aus Riffen vor Honduras, Belize und Panama.
Mehr Informationen:
Was führt zu einer schnellen Artenaufspaltung in Korallenriffen? (leibniz-zmt.de)

(Bild: Oscar Puebla, ZMT)
Ein Schritt voraus: Wie Pflanzen gefährliche Mutationen vermeiden
17.01.2022
Mehr Informationen: Artikel (mpg.de)
_170122.jpg)
Licht ins Dunkel: unbekannte Insektenvielfalt in Deutschland
15.01.2022
Mehr Informationen: SNSB – Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns » Licht ins Dunkel: unbekannte Insektenvielfalt in Deutschland

(Bild: C. Chimeno, SNSB – Zoologsiche Staatssammlung München)
Rangezoomt: Mensch-Natur-Beziehungen
14.01.2022
Mehr Informationen: Rangezoomt: Mensch-Natur-Beziehungen | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Thomas Müller/Senckenberg)
Umfassender Praxisleitfaden für DNA-basierte Methoden veröffentlicht
14.01.2022
Mehr Informationen: Umfassender Praxisleitfaden für DNA-basierte Methoden veröffentlicht – LIB (leibniz-lib.de)

(Bild: DNAqua-Net)
Klimawandel bedroht die Artenvielfalt in Hecken
13.01.2022
Mehr Informationen: Klimawandel bedroht die Artenvielfalt in Hecken - Universität Bremen (uni-bremen.de)

(Bild: Kathrin Litza / Universität Bremen)
Die heimlichen Förderer des Baumwachstums
10.01.2022
Mehr Informationen: Die heimlichen Förderer des Baumwachstums | ETH Zürich

(Bild: P.Rüegg / ETH Zürich)
Artenverschiebung aufgrund von Kipppunkt im Humboldt-Strom vor Peru
06.01.2022
Forschende rekonstruieren Zusammenhang zwischen Ozeanerwärmung und Verschiebung zu kleineren Fischarten anhand von Sedimentproben aus dem Humboldtstrom-Gebiet
Grundlegende Veränderungen im Ozean wie eine zunehmende Erwärmung, Versauerung oder Sauerstoffreduzierung können erhebliche Folgen für die Zusammensetzung von Fischbeständen haben – bis hin zur Verdrängung einzelner Arten. Forschende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland, Kanada, den USA und Frankreich anhand von Sedimentproben aus dem Humboldtstrom-Gebiet vor Peru Umweltbedingungen der älteren Warmzeit vor 125.000 Jahren (Eem- Interglazial) rekonstruiert. Sie konnten aufzeigen, dass sich bei wärmeren Temperaturen vor allem kleinere, grundelartige Fischarten durchsetzen und wichtige Speisefische wie die Sardelle (Engraulis ringens) zurückdrängen. Die Entwicklung ist unabhängig von Fischereidruck und Fischereimanagement. Die stärkere Erwärmung des Humboldtstrom-Gebietes als Folge des Klimawandels hat demnach weitreichendere Auswirkungen für das Ökosystem und die weltweite Fischereiwirtschaft als bisher angenommen.
Mehr Informationen: Uni Kiel: Artenverschiebung aufgrund von Kipppunkt im Humboldt-Strom vor Peru (uni-kiel.de)

(Bild: Martin Visbeck, GEOMAR)
Mit Strategie: Biodiversität schützen und dabei Platz sparen
16.12.2021
Die Vielfalt des Lebens auf der Erde ist bedroht, die Biodiversität nimmt rapide ab. Bis zu eine Million Arten sind gefährdet. Viele könnten in den nächsten Jahrzehnten aussterben. Schutzgebiete sind daher dringend notwendig, sie werden jedoch oft strategisch falsch gewählt. Doch wie lässt sich die biologische Vielfalt einer Region sinnvoll beziffern? Mit einem neuen Ansatz hat ein Forschungsteam aus Bogotá gemeinsam mit Dr. Kerstin Jantke von der Universität Hamburg jetzt die wertvollsten Flächen in den amerikanischen Tropen identifiziert.
Mehr Informationen: Mit Strategie: Biodiversität schützen und dabei Platz sparen - Universität Hamburg (uni-hamburg.de)

Kakao-Anbau bietet Fledermäusen und Vögeln Nahrung und Lebensraum
15.12.2021
Kakao-Anbau erlaubt uns nicht nur den Genuss von Schokolade, sondern kann auch die Artenvielfalt fördern. Die Vorteile der Farmen für die biologische Vielfalt wurden in Agrarlandschaften mit Resten von tropischen Regenwäldern umfassend untersucht, waren aber in Regionen mit tropischen Trockenwäldern bisher unbekannt. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Göttingen hat nun erstmals herausgefunden, wie saisonale Effekte das Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen – den wichtigsten Fressfeinden von schädigenden Insekten – in Kakaowäldern in Peru bestimmen.
Mehr Informationen: Presseinformationen - Georg-August-Universität Göttingen (uni-goettingen.de)

(Bild: Carolina Ocampo-Ariza)
Ökologischer Landbau zum Schutz von Biodiversität
13.12.2021
Im EU-Projekt Managing soil biodiversity and ecosystem services in agroecosystems across Europe under climate change (SOILCLIM) untersuchte eine Forschungsgruppe die Auswirkungen von Trockenheit auf Bodenorganismen und Ökosystemfunktionen im ökologischen und konventionellen Landbau.. Ergebnis der Studie ist eine Abnahme der biologischen Aktivität im Boden und eine erhebliche Schwächung des Beitrags der Bodenlebewesen zu Ökosystemfunktionen unter konventioneller Bewirtschaftung.
Mehr Informationen: Ökologischer Landbau zum Schutz von Biodiversität - BTU Cottbus-Senftenberg (b-tu.de)

(Bild: Dominika Kundel)
Die Einzigartigkeit verschwindet
12.12.2021
Pflanzengemeinschaften werden sich immer ähnlicher, selbst zwischen weit voneinander entfernten Regionen unseres Planeten. Grund ist die Ausbreitung gebietsfremder Pflanzenarten, so das Ergebnis eines globalen Forschungsprojektes unter Leitung Konstanzer Biologinnen und Biologen und mit Beteiligung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv). Die Ergebnisse der Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurden, unterstreichen die Wichtigkeit effektiver Schutzmaßnahmen für den Erhalt regionaler Einzigartigkeit.
Mehr Informationen: Die Einzigartigkeit verschwindet (idiv.de)

(Bild: Franz Essl)
Schnelle Erholung tropischer Wälder bietet viele kurzfristige Vorteile
09.12.2021
Tropische Wälder werden mit einer alarmierenden Geschwindigkeit abgeholzt. Die gerodeten Flächen dienen meist der Landwirtschaft oder Weidehaltung und werden nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Auf dem verlassenen Land kann der Wald auf natürliche Weise nachwachsen und sogenannten Sekundärwald bilden. Eine Studie, die diese Woche in Science veröffentlicht wurde, zeigt, dass sich nachwachsende Tropenwälder überraschend schnell erholen und nach 20 Jahren fast 80 % der Bodenfruchtbarkeit, Kohlenstoffspeicherung und Baumvielfalt von Urwäldern erreichen können. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass natürliche Regeneration eine kostengünstige und naturbasierte Lösung für den Klimaschutz, den Erhalt der biologischen Vielfalt und die Wiederherstellung von Ökosystemen darstellt.
Mehr Informationen: Schnelle Erholung tropischer Wälder bietet viele kurzfristige Vorteile (uibk.ac.at)

(Bild: Uni Innsbruck)
Spaß am Naturschutz und Gutes tun
08.12.2021
Was treibt ehrenamtlich Forschende – sog. Citizen Scientists – an, sich in ihrer Freizeit an Untersuchungen zur biologischen Vielfalt, speziell dem Monitoring von Insekten, zu beteiligen? Dieser Frage ist ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Anett Richter vom Thünen-Institut für Biodiversität in Braunschweig nachgegangen. Ziel war es, ein klareres Bild über die Motivationen zu bekommen, um Ehrenamtliche besser in internationale Monitoringprogramme einbinden zu können.
Mehr Informationen: Thünen-Institut: Spaß am Naturschutz und Gutes tun (thuenen.de)
.jpg)
(Bild: Anett Richter)
Jungkorallen geben Einblick in die Erholung nach Korallenbleiche
08.12.2021
Die durch den Klimawandel verursachte Ozeanerwärmung und die dadurch steigende Frequenz und Schwere von Korallenbleichen stellen weltweit die größte Bedrohung für Korallenriffe dar. Wie schnell sich Korallenriffe von solchen Bleichen erholen können ist daher von großem Interesse – die Anzahl an Jungkorallen gibt dabei einen guten Einblick. Wissenschaftler:innen eines internationalen Forschungsprojekts der Abteilung Marine Ökologie der Universität Bremen in Partnerschaft mit der Seychelles Islands Foundation (SIF) haben dies in einem abgelegenen Atoll im Indischen Ozean erforscht und fanden Vielversprechendes: innerhalb von vier Jahren nach der Korallenbleiche von 2016 stieg die Anzahl an Jungkorallen auf das 2 bis 3-fache, verglichen mit der Situation direkt nach der Bleiche.
Mehr Informationen: Jungkorallen geben Einblick in die Erholung nach Korallenbleiche - Universität Bremen (uni-bremen.de)

(Bild: Anna Koester)
Der Süßwasser-Biodiversität einen Platz am Tisch einräumen
01.12.2021
Forschende aus 90 Wissenschaftseinrichtungen weltweit, darunter das Museum für Naturkunde Berlin, stellen fest: Die Erforschung und der Schutz der Süßwasser-Biodiversität bleiben weit hinter denen im terrestrischen und marinen Bereich zurück. Sie haben in der Fachzeitschrift Ecology Letters eine Forschungsagenda mit 15 Prioritäten veröffentlicht, mit denen es gelingen soll, die biologische Vielfalt in Seen, Flüssen und Feuchtgebieten besser zu erforschen und zu schützen. Das ist dringend nötig, denn der Artenverlust schreitet in Binnengewässern schneller voran als an Land und im Meer.
Mehr Informationen: Der Süßwasser-Biodiversität einen Platz am Tisch einräumen | Museum für Naturkunde (museumfuernaturkunde.berlin)

Klimaveränderungen und Überfischung dezimierten Ostseehering lange vor der Industrialisierung
01.12.2021
Der Zusammenbruch der Sundfischerei in der westlichen Ostsee Ende des 16. Jahrhunderts war die Folge von Überfischung und einer rapiden Veränderung des Klimas – ähnliche Bedingungen wie sie auch heute vorherrschen. Ein Team aus Historikern sowie Fischereiökonomen und Biologen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig hat die Entwicklung der Heringsfischerei in der Ostsee zwischen 1200 und 1650 rekonstruiert. Demnach kollabierte die damals wichtigste Fischerei auf den herbstlaichenden Hering in den 1580er Jahren innerhalb kürzester Zeit, ohne sich bis heute erholen zu können. Die Forscher erkennen darin Parallelen zur aktuellen Entwicklung kommerziell genutzter Fischbestände in der westlichen Ostsee.
Mehr Informationen: Klimaveränderungen und Überfischung dezimierten Ostseehering lange vor der Industrialisierung; (idiv.de)

(Bild: Aquarium GEOMAR, Jan Steffen)
Wertvolles Leben im Eis
Die Bedeutung Meereis-assoziierter Lebewesen für den Kohlenstoffkreislauf der Arktis
24.11.2021
Senckenberg-Wissenschaftlerin Angelika Brandt hat mit Erstautorin Julia Ehrlich vom Centrum für Naturkunde (CeNak) am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels in Hamburg und vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) sowie mit einem internationalen Team untersucht, wie viele und welche Meereis-assoziierte Organismen in der Region Spitzbergen zu finden sind. Das dortige Arktische Meer ist mit drastischen Umweltveränderungen konfrontiert, die sich massiv auf das Leben im und unter dem Eis auswirken – mit Konsequenzen für das gesamte marine Ökosystem.
Mehr Informationen: Wertvolles Leben im Eis | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Ehrlich/AWI)
Fledermäuse im Himalaya sind in hohen Lagen funktionell weniger vielfältig als in niedrigeren lagen - bei gleicher evolutionärer Diversität
24.11.2021
Millionen Jahre der Evolution haben zu einer immensen Vielfalt an Arten geführt, von denen jede auf einzigartige Weise an ihre Umwelt angepasst ist. Eine einfache Methode zur Messung der biologischen Vielfalt ist über die Anzahl der Arten (taxonomische Vielfalt), doch in jüngerer Zeit gewinnen weitere Maße an Bedeutung: die funktionelle Vielfalt – also die Vielfalt der phänotypischen Merkmale, die es den Organismen ermöglichen, ihre ökologischen Funktionen zu erfüllen – und die phylogenetische Vielfalt, d. h. die Vielfalt der Verästelungen im Baum des Lebens. In der veröffentlichten Arbeit vergleicht ein Wissenschaftsteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) diese Ansätze: Es fand heraus, dass Artenreichtum und funktionelle Vielfalt von Fledermausgemeinschaften im Himalaya mit zunehmender Höhe abnehmen, die phylogenetische Vielfalt jedoch gleich bleibt. Ihre Ergebnisse geben Aufschluss über die Vielfalt der Fledermäuse im Himalaya und dienen als wichtige Grundlage für die Bewertung dieser Vielfalt im Kontext von Umweltveränderungen.

(Bild: Chakravarty R/Leibniz-IZW)
Biologische Vielfalt: Zeit, endlich zu handeln
23.11.2021
Um die globalen Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu erreichen, muss die Umsetzung auf nationaler Ebene deutlich verbessert werden. Verbindliche Maßnahmen und verantwortliche Akteure müssen klar definiert und die Umsetzung durch systematisches Monitoring überwacht werden. Diese Empfehlungen stehen im Zentrum eines dreistufigen Rahmenplans, den ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) in der Fachzeitschrift Conservation Letters veröffentlicht hat. Ein erneutes Scheitern der internationalen Vereinbarungen müsse dringend vermieden werden. Vor allem dürfe ein Fehler dieses Mal nicht mehr passieren.
Mehr Informationen: News single view (idiv.de)

(Bild: IISD/Mike Muzurakis)
Über 50 Prozent aller Schildkröten bedroht
15.11.2021
Ein Team internationaler Wissenschaftler aus den USA, Frankreich, Australien und Deutschland hat die neunte Auflage des Atlas „Turtles of the World“ veröffentlicht. In der Publikation finden sich nicht nur detaillierte Beschreibungen aller 357 Schildkrötenarten, sondern auch Informationen zum Gefährdungsstatus aller Arten sowie ein Vergleich ihrer heutigen und ursprünglichen Verbreitungsgebiete. Die Ergebnisse der Forscher rund um Erstautor Anders G.J. Rhodin (Chelonian Research Foundation und Turtle Conservancy), sind alarmierend: Etwa die Hälfte der Schildkrötenarten sind vom Aussterben bedroht. Den Tieren macht insbesondere der Verlust ihrer Lebensräume sowie der übermäßige Fang zum Verzehr und für den Tierhandel zu schaffen.
Mehr Informationen: Über 50 Prozent aller Schildkröten bedroht | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Rick Hudsonn)
Neue Studie zur Biodiversität: Die Vielfalt ökologischer Funktionen auf Meeresinseln sinkt
12.11.2021
Die Artenvielfalt von Ökosystemen hat sich weltweit unter dem Einfluss des Menschen stark verändert. Ein Forschungsteam mit Prof. Dr. Manuel Steinbauer von der Universität Bayreuth hat diese Prozesse am Beispiel von Vögeln auf Ozeaninseln untersucht. Die in „Science Advances“ veröffentlichte Studie zeigt: Die Zahl gebietsfremder Arten, die sich neu ansiedeln, ist oft höher als die Zahl der unter anthropogenen Einflüssen ausgestorbenen Arten. Doch können die zugewanderten Arten die diversen ökologischen Funktionen ausgestorbener Arten nicht in vollem Umfang ersetzen. Einheimischer Artenschwund bewirkt daher langfristig eine Vereinheitlichung von Ökosystemen und ihrer Funktionen.
Mehr Informationen: Neue Studie zur Biodiversität: Die Vielfalt ökologischer Funktionen auf Meeresinseln sinkt (uni-bayreuth.de)

(Bild: Tim Blackburn)
Menschliche Einflüsse verändern ein ozeanweites Naturgesetz
11.11.2021
Im Rahmen einer weltweiten Kooperation haben Umweltwissenschaftler erstmals in globalem Maßstab die gleichmäßige Verteilung der Meeresbiomasse auf verschiedene Größenklassen - von Bakterien bis zu Walen - untersucht. Durch Quantifizierung des Ausmaßes menschlicher Einflüsse auf dieses Ökosystem zeigt sich eine dramatische Verschiebung einer der bedeutendsten Größenordnungen der Natur.
Mehr Informationen: Menschliche Einflüsse verändern ein ozeanweites Naturgesetz (11.11.2021) (mpg.de)

Alle europäischen Fledermausarten reagieren sensibel auf künstliches Licht – dies variiert jedoch zwischen Artengruppen und Lebensräumen
09.11.2021
Die künstliche Erhellung der Nacht durch Lampen gilt als zentrale zivilisatorische Errungenschaft mit unzähligen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Vorteilen für den Menschen. Für viele Tiere stellt jedoch die Erhellung der Nacht eine erhebliche Herausforderung dar. Nachtaktive oder lichtscheue Arten werden gezwungen, auf dunkle Bereiche auszuweichen oder ihr Verhalten an die Helligkeit anzupassen. In einem Aufsatz in der Fachzeitschrift „BioScience“ gibt ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) einen umfassenden Überblick über die Effekte von künstlichem Licht auf europäische Fledermausarten.

Neue Modelle unterstützen Naturschützer bei der Wiederkehr des seltensten Seelöwen der Welt
08.11.2021
Nach 200 Jahren kehren die Neuseeland-Seelöwen wieder auf die Hauptinsel Neuseelands zurück. Jahrhunderte der intensiven Verfolgung durch den Menschen haben die Art an den Rand des Aussterbens gebracht. Ihre Rückkehr wird als großer Erfolg des Artenschutzes gefeiert – doch schafft er auch komplexe Herausforderungen.
Mehr Informationen: New models help welcome the world’s rarest sea lion as they return home

(Bild: Jan O. Engler)
Ein natürlicher CO2-Speicher dank symbiotischer Bakterien
03.11.2021
Seegraswiesen bedecken große Küstenbereiche unseres Planeten und bieten dort einen vielseitigen Lebensraum. Außerdem nehmen sie große Mengen Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre auf und speichern ihn im Ökosystem. Um so gut zu gedeihen, brauchen die Seegräser Nährstoffe, hauptsächlich Stickstoff. Bisher glaubte man, dass die Pflanzen den Stickstoff vorwiegend aus dem umgebenden Wasser und Sediment aufnehmen. Diese sind allerdings extrem nährstoffarm. Nun zeigt eine Studie, dass Seegras im Mittelmeer in seinen Wurzeln eine Symbiose mit einem Bakterium unterhält, welches den für das Wachstum notwendigen Stickstoff liefert. Solche Symbiosen waren bisher nur von Landpflanzen bekannt.
Mehr Informationen: Ein natürlicher CO2-Speicher dank symbiotischer Bakterien
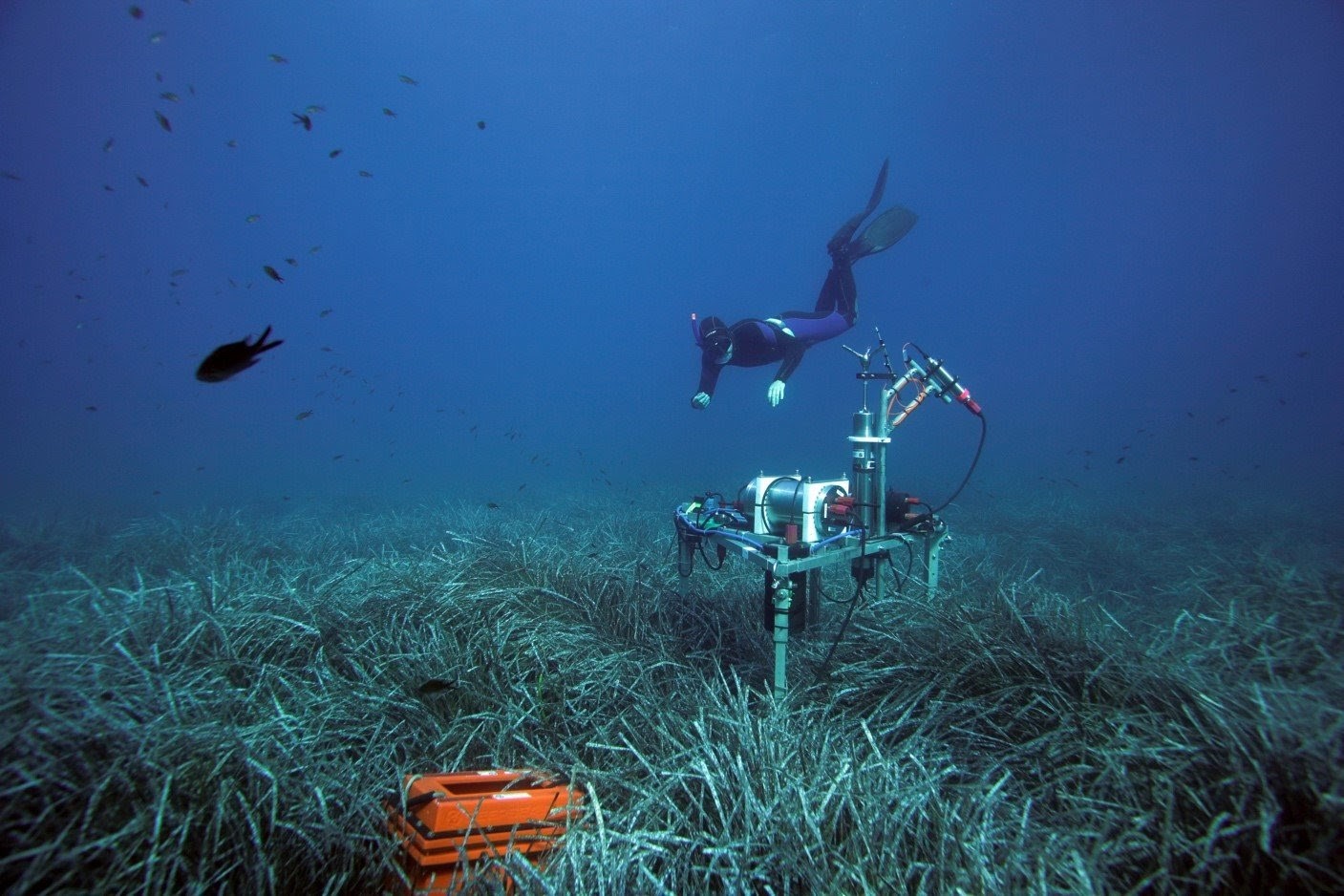
(Bild:Hydra Marine Sciences GmbH)
Tiefgreifender ökologischer Wandel im östlichen Mittelmeer
03.11.2021
Unterschiedliche ökologische Nischen: Tropische Arten verändern die Funktionsweise der Ökosysteme im östlichen Mittelmeer tiefgreifend – mit kaum abschätzbaren Folgen.
Gemeinschaften aus eingeschleppten tropischen Arten unterscheiden sich in ihren biologischen Eigenschaften deutlich von der heimischen Tierwelt im östlichen Mittelmeer, wie ein internationales Forscherteam um Jan Steger vom Institut für Paläontologie herausfand. Dadurch – und durch den fortschreitenden Kollaps mediterraner Arten – verändern sich die Flachwasser-Ökosysteme in der Region besonders tiefgreifend.
Mehr Informationen: Tiefgreifender ökologischer Wandel im östlichen Mittelmeer (univie.ac.at)

(Bild:Jan Steger)
Wale sind die „Gärtner der Meere“
03.11.2021
Die ökologische Bedeutung von Walen für die Ozeane wird offenbar drastisch unterschätzt. Eine internationale Studie zeigt, dass Bartenwale wesentlich mehr Nahrung vertilgen als bislang angenommen - teilweise sogar das Dreifache. Ihre Fäkalien düngen demnach das Wasser nahe der Oberfläche mit großen Mengen Eisen, was wiederum die Menge an Phytoplankton drastisch steigert. Das wirke sich auf die Nahrungskette der Ozeane aus und könne auch den Klimawandel dämpfen, schreibt das Team um Matthew Savoca von der kalifornischen Stanford University im Fachblatt „Nature“.
Mehr Informationen: Wale: Wie wichtig sie für unsere Ozeane sind - WELT

(Bild: John Durban)
Der Frühling wird leiser: Vogelgesang im Wandel
02.11.2021
Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Göttingen und des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten untersucht Klanglandschaften mit Hilfe von Bürgern
Naturgeräusche, insbesondere Vogelgesang, sind wichtig für unsere Verbindung zur Natur. Doch durch veränderte Landnutzung und Klimawandel nimmt die Zahl der Vögel ab. Wie hat sich dies auf unsere Klanglandschaften, also den im Hintergrund immer präsenten Vogelgesang, ausgewirkt? Ein internationales Forschungsteam, an dem auch die Universität Göttingen beteiligt ist, kombinierte Daten aus Vogelmonitoring-Programmen mit Tonaufnahmen einzelner Arten in freier Wildbahn, die durch Bürgerinnen und Bürger gemacht wurden. So konnten sie Klanglandschaften von mehr als 200.000 Aufnahmeflächen in den vergangenen 25 Jahren erstellen. Die Studie zeigt, dass sich die Geräusche des Frühlings verändern: Das Vogelkonzert wird in Nordamerika und Europa leiser und weniger abwechslungsreich.
Mehr Informationen: Presseinformationen - Georg-August-Universität Göttingen (uni-goettingen.de)

(Bild: Hans Glader)
Klimawandel beeinflusst Vererbung in Pflanzen
28.10.2021
Der Klimawandel wird auch Einfluss auf die Vererbung von Pflanzen haben. Ein Team unter Leitung des Fachbereichs Biologie der Universität Hamburg hat nun in Studien untersucht, wie die Meiose in Pflanzenzellen der Art ‚Arabidopsis thaliana‘ unter erhöhten Temperaturen abläuft. Die Folge ist, dass sich der Zeitablauf der Meiose verändert und Rekombinationsdefekte auftreten.
Mehr Informationen:
Klimawandel beeinflusst Vererbung in Pflanzen : Newsroom : Universität Hamburg (uni-hamburg.de)
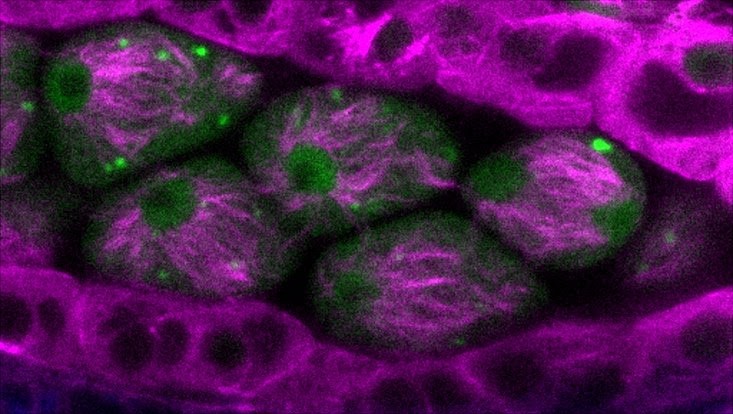
(Bild: UHH/De Jaeger-Braet)
Ohne chemischen Pflanzenschutz steigt die Vielfalt der blühenden Wildpflanzenarten auf den Äckern deutlich
27.10.2021
Äcker nehmen in Deutschland 36 Prozent der Landflächen ein. Weltweit liegt der Schnitt bei rund elf Prozent. Die Art und Weise, wie diese Flächen bewirtschaftet werden, hat großen Einfluss auf die floristische Artenvielfalt und die ökologischen Funktionen der Ackerflächen in der Landschaft. JKI-Studie analysierte nun erstmals langjährig konventionell und ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen parallel zu solchen, auf denen nie Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden.
Mehr Informationen:

(Bild: © J. Hoffmann)
Keine Wildschäden durch Wildschweine auf Magerrasen
TU-Forschungsgruppe untersuchte den Einfluss des Schwarzwildes auf die Biodiversität von Grünland
26.10.2021
Bei der Nahrungssuche durchwühlen Wildschweine unter anderem den Boden, was zu sichtbaren Störungen der Bodenoberfläche in Grünflächen führen kann. Dies hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Biodiversität von Pflanzen und Tieren, die diese Flächen besiedeln. Die Biodiversität der Pflanzen nimmt hierbei im Gesamten nur geringfügig ab, ohne dass eine Gefährdung der einzelnen Arten an sich erkennbar ist. Bei den Tieren hingegen profitieren Heuschrecken und Zauneidechsen von den Aktivitäten der Wildschweine. Zu diesen Ergebnissen kam eine Forschungsgruppe des Fachgebietes Ökosystemkunde/Pflanzenökologie der TU Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Sascha Buchholz und Dr. Moritz von der Lippe.
Mehr Informationen:
Keine Wildschäden durch Wildschweine auf Magerrasen (tu.berlin)

(Bild: Andreas Lischka/Pixabay)
Insektensterben auf tropischen Inseln: Bayreuther Forscher untersuchen Folgen von Urbanisierung und Tourismus
15.10.2021
Touristische Nutzung und eine Ausdehnung städtischer Siedlungsformen stehen in direktem Zusammenhang mit einem massiven Schwund von Insektenarten auf ozeanischen Inseln. Dies haben Wissenschaftler der Universität Bayreuth jetzt durch Forschungsarbeiten auf Malediven-Inseln herausgefunden. Auf Inseln mit fortschreitender Urbanisierung dokumentierten sie im Schnitt 48 Prozent weniger Insektenarten als auf unbewohnten Inseln, auf Touristeninseln sogar 66 Prozent weniger Insektenarten.
Mehr Informationen:

(Bild und Montage: Sebastian Steibl)
Plankton verschiebt sich zu den Polen
15.10.2021
Aufgrund der Erwärmung der Ozeane als Folge des menschlichen Treibhausgas-Ausstosses werden viele Arten des Meeresplanktons neue Lebensräume erschliessen (müssen). ETH-Forschende erwarten, dass viele Organismen zu den Polen wandern und dort neue Artengemeinschaften bilden – mit unabsehbaren Folgen für die marinen Nahrungsnetze.
Mehr Informationen:

(Bild: Adobe Stock/ arostynov)
Rückgang von Pflanzenbestäubern bedroht Artenvielfalt
14.10.2021
Etwa 175.000 Pflanzenarten – die Hälfte aller Blütenpflanzen – sind für die Samenbildung und damit für ihre Fortpflanzung überwiegend oder vollständig auf tierische Bestäuber angewiesen. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, die am 13. Oktober 2021 von einem globalen Forschungsnetzwerk mit Beteiligung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Konstanz in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde. Ein Rückgang in der Zahl dieser Bestäuber könnte daher zu erheblichen Störungen der natürlichen Ökosysteme führen – einschließlich eines Verlustes der biologischen Vielfalt.
Mehr Informationen:
https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/2282.html

(Bild: Prof. Alan Ellis/Stellenbosch University)
Empfindliche Frösche: Der Regenwald heilt langsamer als gedacht
13.10.2021
Wissenschaftler*innen der beiden Leibniz-Einrichtungen Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden und Museum für Naturkunde Berlin haben eine über zwanzig Jahre angelegte Langzeitstudie zur Biodiversität im Regenwald abgeschlossen. Anhand von Froschgemeinschaften im Gebiet der westafrikanischen Elfenbeinküste konnte das Team zeigen, dass sich das Ökosystem fast 50 Jahre nach der Abholzung immer noch nicht erholt hat. Einige Froscharten kehren nie wieder in ihren ursprünglichen Lebensraum zurück.

(Bild: Mark-Oliver Rödel/Museum für Naturkunde Berlin)
“Hilfe zur Selbsthilfe” der Korallenriffe
12.10.2021
Korallenriffe sind die Regenwälder des Meeres. 30 Prozent der marinen Biodiversität ist von Korallenriffen abhängig, wirtschaftlich gesehen sind es global rund eine Milliarde Menschen. Gleichzeitig sind Korallenriffe als Ökosysteme stark vom Klimawandel bedroht. In einer Übersicht, die in der aktuellen Ausgabe des Online-Journals Nature Reviews Earth & Environment erschienen ist, fasst Prof. Dr. Christian Voolstra von der Universität Konstanz gemeinsam mit einer internationalen Gruppe von ExpertInnen natürliche Prozesse zusammen, die die Widerstandsfähigkeit von Korallen als repräsentative Schlüsselarten erhöhen können, um dadurch Korallenriff-Ökosystemen besser zu helfen. Sie plädieren dafür, vielversprechende Ansätze aus der Natur zu identifizieren und daraus Methoden zu entwickeln, um die natürliche Hitzebeständigkeit von Korallen zu erweitern und sie dadurch resistenter zu machen. Ziel ist, ein Arsenal an Methoden für die Hilfe zur Selbsthilfe von Korallen zur Verfügung zu stellen.
Mehr Informationen:
„Hilfe zur Selbsthilfe“ der Korallenriffe | campus.kn (uni-konstanz.de)

Insekten im Klima- und Landschaftswandel
12.10.2021
Weltweit gehen die Menge und die Vielfalt der Insekten zurück: Dafür hat die Wissenschaft in den vergangenen Jahren immer mehr Hinweise gefunden. In Politik und Gesellschaft haben diese Befunde teils große Besorgnis ausgelöst. Forscherinnen und Forscher führen das Insektensterben zum einen auf Veränderungen der Landnutzung zurück, beispielsweise auf die Zunahme großer Monokulturen wie Mais und Raps. Zum anderen nennen sie als Ursache auch den Klimawandel mit vermehrter Hitze und Trockenheit. Doch scheinen diese Befunde Schwächen zu haben, wie der Tierökologe Professor Jörg Müller vom Biozentrum der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) sagt. Die zugrundeliegenden Studien würden bislang unter anderem die Vielfalt der Insektenspezies nicht gut genug abbilden oder nur kurze Zeiträume und kleine Gebiete berücksichtigen. Dieses Manko wollte ein Forschungsteam des bayerischen LandKlif-Netzwerks, koordiniert von der JMU, nun zumindest teilweise beheben. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Verstädterung ein weiterer Schlüsselfaktor ist, der Insekten das Überleben schwermacht.
Mehr Informationen:
Insekten im Klima- und Landschaftswandel - Universität Würzburg (uni-wuerzburg.de)

(Bild: LandKlif-Team)
Artenvielfalt auf den Inseln ist extrem bedroht
11.10.2021
Inseln machen nur 7 Prozent der weltweiten Landfläche aus – doch sie beherbergen 20 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten. Diese Vielfalt ist extrem bedroht. In einem Beitrag in der Zeitschrift „Global Ecology and Conservation“ beschreibt Biogeograph Prof. Severin Irl von der Goethe-Universität zusammen mit Kollegen den Ist-Zustand der Artenvielfalt.
Mehr Informationen:
Goethe-Universität — Pressemitteilungen (uni-frankfurt.de)

„Nature“-Studie: Aussehen von Pflanzen verrät nichts über ihre Wurzeln
07.10.2021
Die große oberirdische Vielfalt der Pflanzen spiegelt sich nur bedingt im Aussehen ihrer Wurzeln wider. Während es oberhalb der Erde sehr viele verschiedene Pflanzenmerkmale und charakteristische Muster gibt, ähneln sich die meisten Arten im Boden stark. Mehr noch: Es gibt offenbar keinen Zusammenhang zwischen "oben" und "unten", wie ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Tartu und Beteiligung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) in der Fachzeitschrift "Nature" schreibt.
Mehr Informationen:
„Nature“-Studie: Aussehen von Pflanzen verrät nichts über ihre Wurzeln (uni-halle.de)
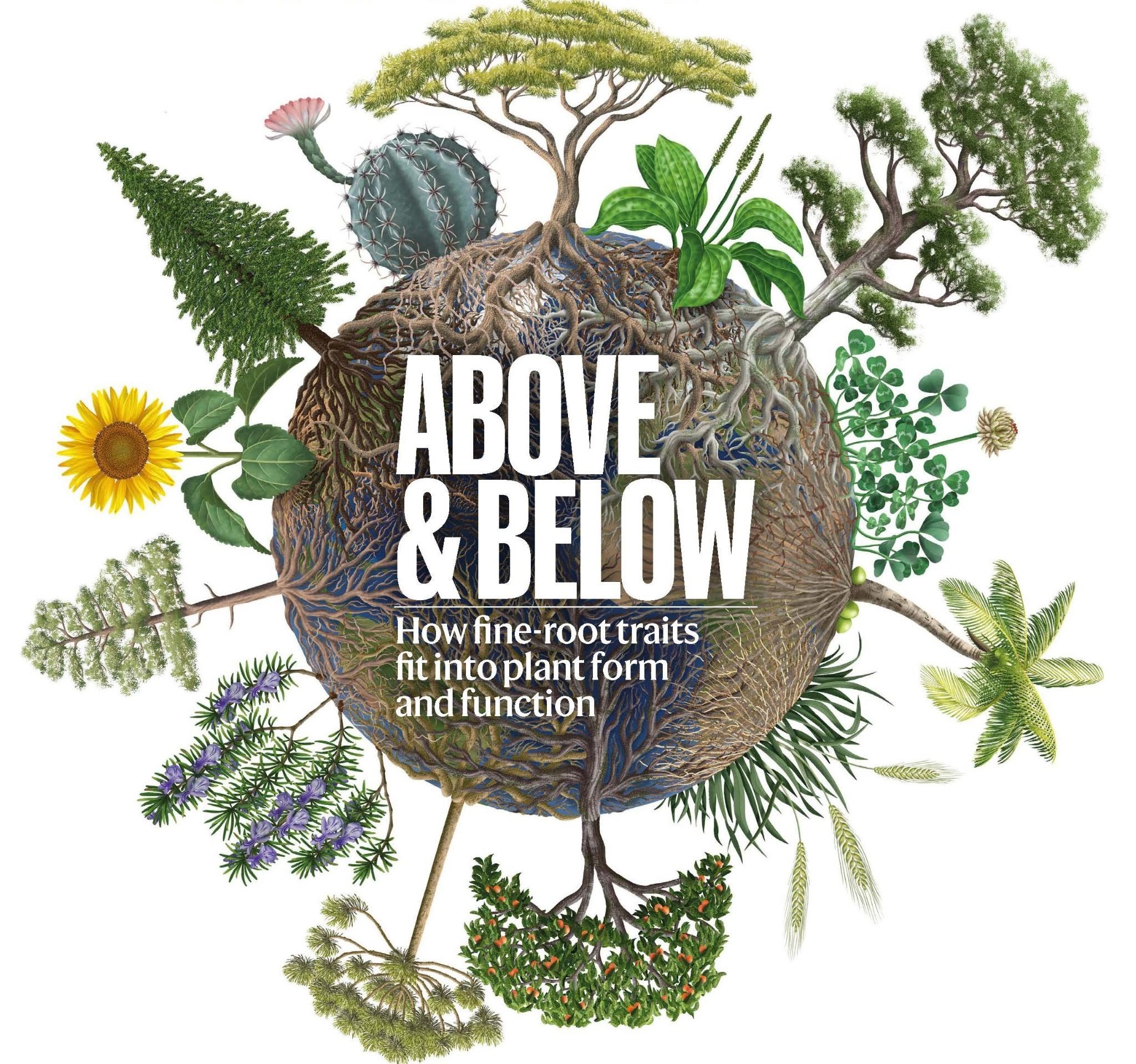
(Bild: Nature)
Immer mehr Straßen aber kaum Wissen über deren Auswirkungen auf Wildtiere
06.10.2021
Gerade in Regionen mit sehr dichtem Straßennetz wie Deutschland gehören Fahrzeuge vermutlich zu den wesentlichen Lebensbedrohungen aller Arten von Wildtieren. Wie stark sich dieser Faktor jedoch auf die Populationen auswirkt, lässt sich mangels Daten leider nicht darstellen. Dies hat nun ein Wissenschaftlerteam unter Leitung der Complutense-Universität Madrid (UCM), dem deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) sowie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) in der Zeitschrift Perspectives in Ecology and Conservation gezeigt. Die Analyse einschlägiger Literatur ergab, dass Studien zu stark auf wenige Regionen und Arten beschränkt sind. Die Wissenschaftler sehen in der systematischen Erfassung von tierischen Verkehrsopfern ein großes Potenzial zur Bewertung des Aussterberisikos von Tierarten.
Mehr Informationen:
News single view (idiv.de)

(Bild: Pixabay)
Große Wassertiere sind durch den Verlust von frei fließenden Flüssen gefährdet
05.10.2021
Der Verlust von frei fließenden Flüssen gefährdet weltweit die biologische Vielfalt in Fließgewässern – und die Fragmentierung von Flüssen dauert an: Mehr als 3.400 große Wasserkraftanlagen mit über einem Megawatt Leistung sind entweder geplant oder im Bau. Forschende unter Leitung des IGB zeigen nun: Wenn alle beabsichtigten Staudämme gebaut werden, verlieren weltweit 19 Prozent der Flüsse mit über 500 Kilometern Länge, in denen große Tiere vorkommen, ihren Status als frei fließende Gewässer. Und ein weiteres Ergebnis ist: Fließgewässer, in denen Dämme und andere Bauwerke geplant sind, beherbergen heute noch den höchsten Artenreichtum an großen Tieren – mehr als die dann verbleibenden frei fließenden Flüsse oder solche, die bereits verbaut sind.
Mehr Informationen:
Große Wassertiere sind durch den Verlust von frei fließenden Flüssen gefährdet | IGB (igb-berlin.de)

Wiedervernässte Moore sind neuartige Ökosysteme
05.10.2021
Ein Forschungsteam unter Federführung von Wissenschaftler*innen der Universitäten Greifswald und Rostock hat den Erfolg der Wiedervernässung durch den Vergleich von 320 wiedervernässten mit 243 naturnahen Niedermoorstandorten mit vergleichbarer Entstehungsgeschichte in den gemäßigten Breiten Europas untersucht. Überraschenderweise bleiben die Unterschiede zwischen wiedervernässten und naturnahen Mooren hinsichtlich Biodiversität (Vegetation) und Ökosystemfunktionen (charakterisiert durch z.B. geochemische und hydrologische Parameter) lange erhalten. Bis zu drei Jahrzehnte nach Wiedervernässung konnte im Mittel kein Trend hin zu den Bedingungen in naturnahen Mooren nachgewiesen werden. Stattdessen entstehen lokal neuartige Ökosysteme
Mehr Informationen:
Wiedervernässte Moore sind neuartige Ökosysteme - Universität Greifswald (uni-greifswald.de)

(Bild: ©Stephan-Busse)
Urzeitliche Parasiten berichten vom Überleben und Sterben von Arten
05.10.2021
Schon vor Millionen Jahren gab es Lebewesen, die auf Kosten anderer lebten. Auch wenn diese Ur-Parasiten ihren Zeitgenossen lästig waren, verraten sie uns viel über das Funktionieren von Ökosystemen und das Überleben und Sterben von Arten – auch heute in Zeiten des Klimawandels. Ein Wissenschaftler, der diese Botschaften aus der Urzeit entschlüsseln kann, ist Dr. Kenneth De Baets. Der Geologe forscht am Geozentrum Nordbayern der FAU.
Mehr Informationen:
Urzeitliche Parasiten berichten vom Überleben und Sterben von Arten | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (fau.de)

Namen aller Kakteen veröffentlicht – Wichtige Grundlage zum Schutz gefährdeter Arten
29.09.2021
Geliebt, bewundert und stark gefährdet: Kakteen gehören zu den beliebtesten Zimmerpflanzen – einige Arten sind jedoch in der Natur fast verschwunden. Ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlern hat jetzt in über 2-jähriger Arbeit eine komplette Checkliste aller bekannten Kakteenarten und ihrer aktuell gültigen Namen erstellt. Das Ergebnis ist als Teil des botanischen Großprojektes „World Flora Online“ eine entscheidende Wissensgrundlage zum Erhalt der Artenvielfalt im Rahmen der UN-Konvention für biologische Vielfalt.
Mehr Informationen:
Namen aller Kakteen veröffentlicht – Wichtige Grundlage zum Schutz gefährdeter Arten | Botanischer Garten Berlin

(Bild: N. Köster)
Erfolg durch genetische Diversität: Ameisenkolonien ziehen mehr Nachkommen auf
28.09.2021
Ameisenkolonien mit größerer genetischer Diversität sind erfolgreicher als Kolonien, die aus Individuen gleicher Abstammung bestehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine experimentelle Studie, bei der verschiedene Kolonien der Schwarzen Wegameise miteinander verglichen wurden. "Wir vermuten, dass eine größere Diversität zu einer besseren Arbeitsteilung unter den Ameisenarbeiterinnen führt und in der Folge die Leistung der Kolonie insgesamt zunimmt", erklärt der Leiter der Studie, Dr. Romain Libbrecht von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU). Ameisenkolonien, in denen sich die einzelnen Ameisen stärker voneinander unterscheiden, ziehen mehr Larven groß als Kolonien aus enger verwandten Tieren.
Mehr Informationen:
Erfolg durch genetische Diversität: Ameisenkolonien ziehen mehr Nachkommen auf (uni-mainz.de)

Geologisch lebendige Kontinente erzeugen höhere Artenvielfalt
27.09.2021
Dank eines neuen Computermodells können Forschende der ETH Zürich nun besser erklären, weshalb die Regenwälder Afrikas weniger Arten beherbergen als die Tropenwälder Südamerikas und Südostasien. Der Schlüssel zu einer hohen Artenvielfalt ist, wie dynamisch sich die Kontinente über die Zeit entwickelt haben.
Mehr Informationen:
Geologisch lebendige Kontinente erzeugen höhere Artenvielfalt | ETH Zürich

(Bild: AdobeStock / ondrejprosicky)
Ungleich ist ungleich besser
23.09.2021
Je höher die biologische Vielfalt in einem Ökosystem ist, desto besser funktionieren die wichtigen Prozesse dort. Eine vielfältige Umwelt fördert diesen Effekt, intensive Landnutzung schwächt ihn ab, wie eine neue Studie zeigt. Forschende haben untersucht, ob die Vielfalt der Umwelt einen Unterschied für den positiven Effekt biologischer Vielfalt auf Ökosystemfunktionen macht. Die Forschenden arbeiten mit Daten aus 13 natürlichen und menschgemachten Ökosystemen am höchsten Berg Afrikas, dem Kilimandscharo. Es ist eine der ersten Studien, die solch eine Fragestellung in realen Ökosystemen entlang eines Höhengradienten von mehr als 3500 Höhenmetern untersucht.
Mehr Informationen:
Ungleich ist ungleich besser - Universität Würzburg (uni-wuerzburg.de)

(Bild: Andreas Hemp)
Durchsichtig mit winzigem Gehirn: Neue Fischart in Myanmar entdeckt
23.09.2021
Senckenberg-Wissenschaftler Ralf Britz hat mit internationalen Kollegen eine neue Art aus der Fischgattung Danionella beschrieben. Aufgrund der fehlenden Schädeldecke und des transparenten Körpers ist das Gehirn der winzigen Fische im Lebendzustand sichtbar. Sie gelten daher als ideale Modellorganismen für neurophysiologische Forschung.
Mehr Informationen:
Durchsichtig mit winzigem Gehirn: Neue Fischart in Myanmar entdeckt | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Senckenberg)
Den unsichtbaren Stress eines Waldes erkennen
22.09.2021
Als Naturfreunde erkennen wir leicht, ob ein Baum krank oder schwach ist - zum Beispiel an der Verfärbung oder am Verlust von Blättern. Zu diesem Zeitpunkt sind die Schäden aber schon fortgeschritten und oft unumkehrbar. In einer neuen Studie zeigen Forschende der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL wie sich der Stress eines Baumes frühzeitig erkennen lässt. Dafür setzen sie Spektraldaten aus Drohnenfotos ein.
Mehr Informationen:
Den unsichtbaren Stress eines Waldes erkennen - WSL

(Bild: Frederik Baumgarten, WSL)
Insekten unter Wasser reagieren empfindlich auf Lichtverschmutzung
22.09.2021
Lichtverschmutzung – also zu viel künstliches Licht zur falschen Zeit am falschen Ort – ist vermutlich ein Grund für das weltweite Insektensterben. Denn viele Fluginsekten sind lichtempfindlich und werden von künstlichen Lichtquellen wie von Staubsaugern angezogen und fehlen dann in ihrem Lebensraum. Dieser Effekt ist mittlerweile gut bekannt. Neue Forschungsergebnisse des IGB zeigen, dass der Staubsaugereffekt auch unter Wasser gilt und dass die derzeitigen Strategien zur Verringerung der Auswirkungen der Lichtverschmutzung nicht weit genug gehen, um aquatische Insektenarten zu schützen.
Mehr Informationen:
Insekten unter Wasser reagieren empfindlich auf Lichtverschmutzung | IGB (igb-berlin.de)

(Bild: Shutterstock, Fatseyeva)
Grasland in Gefahr
22.09.2021
Graslandschaften sind weltweit Oasen biologischer Vielfalt und stellen eine Vielzahl von Leistungen für den Menschen bereit – darunter Nahrungsmittel, Wasserversorgung und die Speicherung von Kohlenstoff. Die Zukunft dieser Ökosysteme sieht jedoch düster aus, sollten keine Maßnahmen ergriffen werden, um die Degradierung der Grasländer aufzuhalten und ihre Renaturierung zu fördern, so die Autor*innen einer Studie im Fachjournal „Nature Reviews Earth & Environment“. Ein internationales Expert*innenteam, unter der Leitung der Universität Manchester, schlägt in der kürzlich erschienenen Publikation eine Reihe von Strategien vor, um die weltweite Zerstörung von Graslandschaften zu stoppen und ihre Wiederherstellung zu fördern.
Mehr Informationen:
Grasland in Gefahr | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

(Bild: Richard Bardgett)
Der Zustand terrestrischer Ökosysteme lässt sich mit drei Schlüsselindikatoren erfassen
22.09.2021
Ökosysteme erbringen vielfältige Dienstleistungen für den Menschen. Diese hängen von grundlegenden Ökosystemfunktionen ab, die sowohl durch das vorherrschende Klima und Artenvorkommen als auch durch menschliche Eingriffe beeinflusst werden. Ein großes internationales Forschungsteam unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie (MPI-BGC) in Jena hat drei Schlüsselindikatoren ermittelt, die die Funktionsweise terrestrischer Ökosysteme beschreiben: 1) die Fähigkeit, die Primärproduktivität zu maximieren, 2) die Effizienz der Wassernutzung und 3) der Wirkungsgrad der Kohlenstoffnutzung. Das Monitoring dieser drei Kennzeichen ermöglicht es, einzuschätzen, wie anpassungsfähig ein Ökosystem gegenüber Klima- und Umweltveränderungen ist und wie es sich unter bestimmten Bedingungen weiterentwickeln kann.
Mehr Informationen:
Max-Planck-Institut für Biogeochemie | PublicRelations / NewsSingle (mpg.de)

(Bild: Marta Galvagno, ARPA Valle d'Aosta, Italien)
Artensterben auch in der Literatur
17.09.2021
Die Menschen scheinen sich immer mehr von der Natur zu entfremden. Das legt eine umfangreiche Literaturanalyse nahe. Die biologische Vielfalt nimmt in der westlich geprägten Literatur seit den 1830er Jahren kontinuierlich ab. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen, interdisziplinären Studie, die von Leipziger Forschern geleitet wurde.
Mehr Informationen:
News single view (idiv.de)
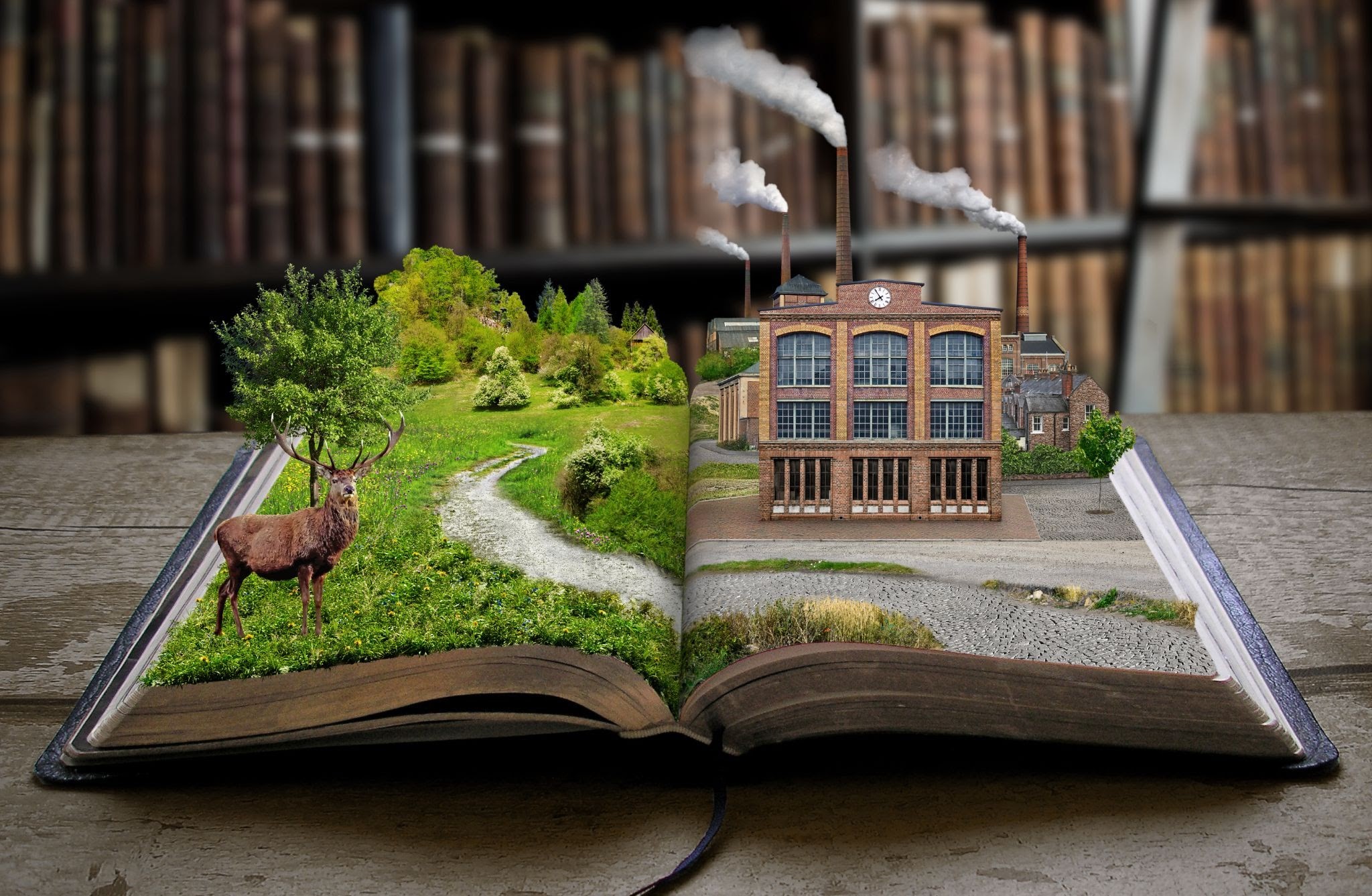
(Bild: Gabriele Rada / iDiv)
Über 25.000 Jahre Einfluss der Umwelt auf die Tierwelt
15.09.2021
Schon bevor Menschen sich auf Madagaskar ansiedelten, beeinflussten Umweltveränderungen die dort lebenden Lemurenpopulationen. In einem interdisziplinären Projekt untersuchte ein Team unter Leitung von apl. Professorin Dr. Ute Radespiel, Institut für Zoologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo), und Professor Dr. Hermann Behling, Abteilung Palynologie und Klimadynamik der Georg-August-Universität Göttingen, den Einfluss von Umweltveränderungen über die letzten 25.000 Jahre auf die Tierwelt von Madagaskar. In der Zeitschrift Communications Biology berichten sie in einem heute veröffentlichten Artikel, dass der Rückgang madagassischer Wildtiere im Norden der Insel bereits erheblich war, bevor Menschen Einfluss darauf nahmen.
Mehr Informationen:
Über 25.000 Jahre Einfluss der Umwelt auf die Tierwelt - TiHo Hannover (tiho-hannover.de)

(Bild: Vincent Montade)
Neubau des Forschungszentrums iDiv eingeweiht
15.09.2021
Die Ministerpräsidenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben am Mittwoch gemeinsam mit der DFG-Generalsekretärin Heide Ahrens den Forschungsneubau des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) feierlich eröffnet. Über 100 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, die unter strengen Hygieneschutzmaßnahmen stattfand. Sie erfuhren, welchen Beitrag iDiv zur Lösung der globalen Biodiversitätskrisen leistet und künftig leisten will. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel schickte eine Grußbotschaft. Der Neubau an Leipzigs Alter Messe ist als Ort des Ideenaustauschs und der integrativen Forschung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt konzipiert. Ab 2024 wollen die drei Länder gemeinsam mit weiteren Förderern die Finanzierung des Forschungszentrums übernehmen.
Mehr Informationen:
News single view (idiv.de)

(Bild: Swen Reichhold)
Seegraswiesen als Vibrionen-Fänger
15.09.2021
Sie helfen, den Klimawandel zu mindern und Algenblüten zu verhindern – und sie können laut neuesten Forschungsergebnissen auch die Konzentrationen potenziell gesundheitsschädlicher Bakterien im Meerwasser senken: Seegraswiesen erbringen einer jetzt veröffentlichten Studie von Kieler Forschenden zufolge eine weitere Ökosystemleistung für uns Menschen. Die Ergebnisse liefern einen weiteren Anreiz für den Schutz und die Wiederherstellung dieser lange unterschätzen Ökosysteme in der deutschen Ostsee.
Mehr Informationen:
Seegraswiesen als Vibrionen-Fänger - GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Taucher nehmen Wasserproben in der Seegraswiese. (Bild: Christian Howe)
Waldränder in den Tropen verstärken Kohlenstoffemissionen
06.09.2021

