Struktur des Projektes
Das Projektvorhaben ist wie folgt in Teilprojekte (TP) strukturiert und im folgenden aufgelistet:
- TP 1: Integrierte räumliche Datenanalyse mit Laserscanner- und multispektralen Fernerkundungsdaten für das Hochwasserrisikomanagement [IRADA] (Prof. Gläßer, MLU Halle)
- TP 2: Untersuchungen zum Schadstofftransport in der vereinigten Mulde bei Hochwasser, Parameteranpassung (Dr. v. Tümpling, Dipl. Chem. Baborowski, UFZ)
- TP 3: Hydraulische und Schwebstoff-Modellierung (Dr. Rode, UFZ)
- TP 4: Modellierung der Schadstoffausbreitung (Prof. Matthies, Uni Osnabrück)
- TP 5: Integrierte Risikobewertung und Entscheidungshilfesystem (J. Schanze, Dr. Walz, IÖR)
- TP 6: Koordination (Dr. v. Tümpling, Dr. Rode, UFZ)
Das Verbundprojekt besteht aus 5 eng miteinander verbundenen und aufeinander aufbauenden Teilprojekten sowie der Koordinierung. Das folgende Schema zeigt die Grundzüge des Datenflusses sowie die Schnittstellen zwischen den Teilprojekten.
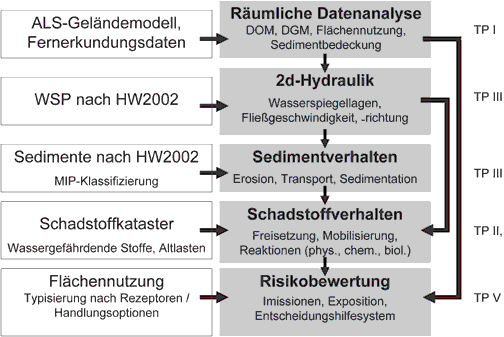
Abbildung: Vernetzung der Teilprojekte
Der Arbeitsablauf im Verbundprojekt lässt sich in wesentlichen Arbeitsschritten wie folgt beschreiben:
1. Datenakquisition und Definition der Modellszenarien
Vorhandene Daten wie Fernerkundungsdaten (Laser-Scanning, multispektrale Fernerkundungsdaten), Landnutzungsdaten sowie Schadstoffdaten, unter anderem aus den elektronisch verfügbaren Katastern des Landkreises Bitterfeld und der im Rahmen des Ad-hoc-Projektes erstellten Datenbank, sind durch alle TP zu analysieren, auf ihre Verwertbarkeit im Rahmen des Projektes zu bewerten und in die allen Teilprojektpartnern zugängliche Projektdatenbank zu überführen. TP V identifiziert spezifische Flächennutzungstypen.
In enger Koordination und Absprache aller Teilprojekte ist das Untersuchungsgebiet auf Grundlage der validierten Daten im Detail festzulegen. TP I erstellt daraufhin das DOM (Digitales Oberflächenmodell).
Gemeinsam mit dem Landkreis Bitterfeld und anderen interessierten Endnutzern werden die Randbedingungen für Szenarien festgelegt, die mit dem Modellsystem zu rechnen sind.
2. Entwicklung des Modellsystems
In dieser Arbeitsphase werden zunächst die verschiedenen Teilmodelle erarbeitet. Durch TP I wird aus dem DOM das digitale Geländemodell (DGM) generiert, welches das Gelände ohne Oberflächenstrukturen beschreibt. Auf Basis des DGM und weiteren Informationen wird durch TP III das hydraulische Modell und darauf aufbauend das Sedimenttransportmodell implementiert und kalibriert. Zeitgleich werden notwendige analytische Untersuchungen zur partikelgrößenabhängigen Elementverteilung durch TP II durchgeführt und durch TP IV die einzelstoffspezifischen Teilmodelle zum Schadstoffverhalten (Freisetzung, Phasenpräferenz, Reaktionen) entwickelt. TP V entwickelt Algorithmen für die raumbezogene Risikoanalyse von Stoffimmissionen und die multikriterielle Bewertung von multifaktoriellen stoffbezogenen Hochwasserrisiken.
Die Kopplung der hydraulischen und Schwebstoff-Modellierung (TP III) mit der Modellierung des Schadstoffverhaltens (TP IV) erfolgt über gemeinsam zu spezifizierende Input/Output-Schnittstellen.
3. Szenarienrechnungen und Bewertungen
Mit dem kalibrierten Modell werden die in 1. festgelegten Szenarien hinsichtlich der Strömungsmodellierung und des Schwebstofftransports für unterschiedliche Hochwasserjährlichkeiten und Überflutungszustände simuliert. Es werden hierbei unterschiedliche Annahmen zur hydrologischen Belastung, unterschiedliche Deichbruchszenarien sowie mit unterschiedlichen Annahmen zur Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen aus Quellen im Modellgebiet zu Grunde gelegt.
Für die Ergebnisse der Szenarioanalyse, die von den Teilprojekten II bis IV durchgeführt werden, erfolgt im TP V eine Bewertung mit in 2. entwickelten Algorithmen für die raumbezogene Risikoanalyse. Zur Beurteilung der Effektivität von Vorsorgemaßnahmen wird zudem eine Wichtung vergleichbarer Szenarios vorgenommen.
Eine Validierung des HW2002-Szenarios erfolgt über Vergleich mit den durch MIP-Klassifizierung ermittelten Sedimentationsflächen (TP I) sowie mit analytischen Untersuchungen dieser Flächen, soweit Ablagerungen vom HW 2002 zum Beprobungszeitpunkt sicher identifizierbar sind (TP II).
4. Implementierung des Systems zur Nutzung durch den Landkreis Bitterfeld
Als Endprodukt des Verbundvorhabens wird im TP V ein akteursorientiertes Entscheidungshilfesystem erstellt, in das Ergebnisse der Szenarioanalyse und -bewertung in Form von Risikokarten einfließen. Darüber hinaus enthält das System Grunddaten, insbesondere aus Teilprojekt I, sowie Metadaten mit weiterführenden Informationen. Das Entscheidungshilfesystem ist auf die Bereitstellung und Visualisierung der Szenarioanalysen und -bewertungen ausgerichtet. Das Modellsystem, die Teilmodelle und ihre Schnittstellen, werden umfassend dokumentiert. Die Nutzer werden auf einem speziellen Workshop in die Handhabung des Systems eingewiesen.
|