Coachingteilnehmende

Die Stadtverwaltung Aachen sieht im BlueGreen City Coaching eine willkommene, strukturierte Unterstützung, um notwendige Entwicklungen im Hinblick auf die politisch und rechtlich gesetzten Ziele für einen zukunftsgerechten Umbau der Stadt gezielt und integriert voranzubringen. Unser Anliegen ist es, dauerhafte interdisziplinäre Strukturen aufzubauen und tragfähige Lösungen für gemeinsame Investitionen, deren Finanzierung sowie die langfristige Unterhaltung von Blue Green Infrastructure (BGI), etwa für multifunktionale Flächennutzungen, zu entwickeln. Zentrale Herausforderungen sind dabei die integrierte Planung an innerstädtischen Starkregen- und Hitzeschwerpunkten, die frühzeitige Abstimmung von Raumnutzungen im Untergrund sowie die systematische Umsetzung von multifunktionalen, blau-grünen Flächen auch in der denkmalgeschützten Innenstadt. Zudem möchten wir eine abgestimmte Kommunikation mit privaten Eigentümern, Investoren, Architekten, Ingenieuren und weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft etablieren, um Starkregen- und Hochwasservorsorge kooperativ anzugehen und Niederschlagswasser lokal nutzbar zu machen.
Ein wesentliches Ziel ist die feste Verankerung von BGI als Planungs- und Lösungsansatz in allen relevanten Planungs-, Bau- und Sanierungsprozessen. Dafür braucht es ein gemeinsames Verständnis, klares Commitment und Verantwortungsübernahme von Beginn an, aber auch die Ermächtigung unserer Mitarbeiter*innen, Themen der Blue Green City eigenständig weiterzuentwickeln. Vertrauen in Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sowie geeignete Austauschformate mit Bevölkerung, Expert*innen und Stakeholdern sind für uns entscheidend. Wir erwarten vom Coaching Impulse für praktikable technische, organisatorische und kommunikatorische Lösungen, die wir gemeinsam erproben können, und zugleich eine Stärkung der Netzwerkbildung – sowohl innerhalb Aachens als auch mit anderen Kommunen und erfahrenen Partnern.
Ansprechpartner*in
Dr. Silke Roder
Abteilungsleitung Tiefbau
Fachbereich Mobilität und Verkehr der Stadt Aachen
Lagerhausstr. 20
52078 Aachen
Tel.: 0241-432 68500

Die Folgen der Klimakrise zeigen sich in Braunschweig sehr eindrücklich. Es gab mehrfach Starkregenereignisse, die zum Teil zu erheblichen Sachschäden geführt haben. So erlebte Braunschweig am 22. Juni 2023 in großen Teilen des Stadtgebietes einen Starkregen, bei dem in einer Stunde mehr als 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fielen. Die Feuerwehr teilte mit, dass sie in den letzten 30 Jahren kein solches Unwetter erlebt hat. Innerhalb kürzester Zeit waren Keller, Straßen und Tiefgaragen überflutet. Dann wiederum plagen Hitze und Trockenheit die Stadt, Landwirtschaft und Grünflächen. Braunschweig hat sich mit im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und dem Projekt COABS klar positioniert, will sich auf häufigere Extremwetterereignisse einstellen sowie den Hitzestress der Bevölkerung im Bereich städtischer Wärmeinseln durch integrierte Planungsansätze mindern und die Weichen zu mehr BlauGrün(Grauer) Infrastruktur bzw. Schwammstadt stellen.
Durch die Vernetzung auch mit anderen Städten wird ein breites Spektrum praxisnaher Lösungen erarbeitet werden können.
Die bestehende Verwaltungsstruktur ist für so komplexe, interdisziplinäre Aufgaben wie die Etablierung einer BlauGrünen Infrastruktur noch nicht ausgelegt. Derzeit setzen eher einzelne Organisationseinheiten Pilotprojekte und konzeptionelle Planungen um. Fachbereichs-übergreifende Arbeitsgruppen mit Entscheidungskompetenz fehlen. Bei der Kosten-betrachtung BlauGrüner Maßnahmen liegt der Fokus oftmals auf der kurzfristigen Herstellung, denn langfristige Ersparnisse lassen sich schlecht darstellen und vermarkten. Darüber hinaus sind juristische Fragestellungen zu klären und Satzungsanpassungen zu prüfen.
Vom Coaching wünschen wir uns eine Anschubwirkung. BlauGrün muss von Vorzeigeprojekten zum Alltag des Handelns werden. Wenn es gelingt, die strukturellen Fragestellungen (mögliche Zuständigkeitsregelungen, Finanzierungsoptionen, abgesicherte juristische Handlungsspielräume, u.v.m) durch das Coachings zu beantworten, dann wird auch die großflächige Umsetzung von „Blaugrünen Maßnahmen“ zu erreichen sein.
Ansprechpartner*in
Stadt Braunschweig, FB 61, Referat Grün- und Freiraumplanung, Fr. Melanie Huk, Emailadresse: melanie.huk@braunschweig.de und Hr. Martin Altrock, Emailadresse: martin.altrock@braunschweig.de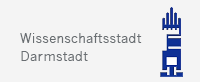
Für eine erfolgreiche kommunale Klimaanpassung ist eine integrierte Vorgehensweise unter Mitwirkung verschiedenster Ämter, Verwaltungsstellen und Eigenbetriebe erforderlich. In diesem Zusammenhang erhoffen wir uns einen Mehrwert im Hinblick auf geeignete Organisationsformen für integriertes Handeln.
Mit der Erstellung des kommunalen, integrierten Klimaanpassungsplans rückt insbesondere die Implementierung blaugrüner Infrastrukturen in unseren Fokus. Wir erhoffen uns mittels Kosten-Nutzen-Rechnungen (auch der weichen Faktoren von Ökosystemleistungen) ökonomische und gesellschaftliche Vorteile der Maßnahmen sichtbar zu machen, aber auch weitere Argumente pro naturbasierter Lösungen zu sammeln und diese gegenüber Stadtgesellschaft, anderen Ämtern und politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern verständlich zu machen (u.a. Förderung der Biodiversität, Stadtgesundheit, sozialer Austausch und soziale Gerechtigkeit sowie verringerte Gesundheitskosten). Zudem sollen Lösungen aufgezeigt werden, wie Maßnahmen auf dem Weg von der Theorie in die Praxis gebracht werden können.
Da aufgrund der relativen Neuheit des Aspekts Klimaanpassung in der Stadtentwicklung viele andere Bereiche stärker und länger gesetzlich verankert bzw. in Normen festgehalten sind, erhoffen wir uns weiterhin Unterstützung hinsichtlich rechtlicher Argumentationshilfen zu Förderung der Klimaanpassung vor Ort.Die Wissenschaftsstadt Darmstadt zählt zu den am meisten von der Klimakrise betroffenen Regionen Deutschlands. Im Oberrheingraben gelegen, zählt Darmstadt zu den heißesten Städten Deutschlands mit einer besonders hohen Anzahl an Hitzetagen und Tropennächten. Hitzewellen treten häufiger und intensiver auf und dauern länger an. Hinzu kommt eine vermehrte Sommertrockenheit mit Absterben und Vitalitätsverlusten der Stadtnatur und des Stadtwaldes. Die dritte große Verwundbarkeit ist die Zunahme von Starkniederschlägen, welche immer wieder zu lokalen Überflutungen und voll gelaufenen Kellern im Stadtgebiet führen.
- Stärkung der interkommunalen Vernetzung
- gegenseitiges Lernen voneinander
- neue Perspektiven auf bekannte Problemlagen
- Umgang und Lösungsansätze bei begrenzten Haushaltsmitteln, personellen Engpässen
- Wege aufzeigen von der Theorie in die Praxis
- Fördermöglichkeiten für Anpassungsmaßnahmen
- Begleitung einer Initiativmaßnahme
Ansprechpartner*in
Die Stadt Freiburg im Breisgau ist aufgrund der geographischen Lage sehr vulnerabel gegenüber extremen Wetterereignissen wie Starkregen, Hochwasser und Hitzewellen. Auch längere Trockenphasen stellen die Stadtverwaltung aktuell und zukünftig vor eine Vielzahl an Herausforderungen. Mit dem gleichzeitig hohen Siedlungsdruck ist die Stadtverwaltung angehalten hinsichtlich der Infrastruktur klimaangepasste und nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen. Eine große Herausforderung stellt dabei die geringe Flächenverfügbarkeit bei gleichzeitig hohem Nutzungsdruck (Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, Mobilitätskonzept, Barrierefreiheit, etc.) dar. Erschwert wird die Umsetzung durch langwierige Planungsprozesse und die notwendige ämterübergreifende Kommunikation.
Durch das Coaching erwarten wir uns gezielte Unterstützung in der verwaltungsinternen Kommunikation und bei der Ausarbeitung von Standardsystemen und Festsetzung. Außerdem wünschen wir uns durch das Coaching einen Erfahrungsaustausch und engeren Wissenstransfer mit den beteiligten Städten und Kommunen.
Ansprechpartner*in
Garten- und Tiefbauamt Stadt Freiburg, Leoni Knoll

In Göttingen stellt die klimaangepasste Umgestaltung des öffentlichen Raums eine zentrale Zukunftsaufgabe dar. Wir möchten die Chancen des Projekts nutzen, um Klimaanpassung nicht nur punktuell, sondern strategisch und integriert anzugehen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Leitungsträgern und weiteren Akteuren der Stadtgesellschaft eine tragfähige Vision und Strategie für die nachhaltige Integration Blau-Grüner Infrastrukturen in die Umgestaltung von Straßen und Plätzen zu entwickeln. Dabei knüpfen wir an den Stadtwasserhitzeplan Göttingen an, unser Konzept für eine hitze- und wassersensible Stadtentwicklung, dessen Ergebnisse wir langfristig im städtischen Handeln verankern möchten.
Im Straßenraum treffen zahlreiche Interessen aufeinander: Bäume als wirksamer Hitzeschutz stoßen häufig auf Konflikte mit bestehenden Leitungen und Infrastrukturen, während der Ausbau von Fernwärme bei gleichzeitigem Erhalt bestehender Netze den Wettbewerb um den knappen Raum zusätzlich verschärft. Besonders im historischen Stadtkern erschwert das dichte Leitungsnetz eine Umsetzung. Hier liegen aber genau auch unsere Hitze-Hotspots und naturbasierte Lösungen als Win-Win-Maßnahmen sind wichtiger denn je. Hinzu kommt, dass die Schaffung Blau-Grüner Infrastruktur eine relativ neue aber wichtige Aufgabe ist. Daher müssen Prozesse zur Installation und dem Betrieb etwas bzgl. der Regenwassernutzung, dem Einsatz von Zisternen oder zur Integration nachhaltiger Bewässerungstechniken erst entwickelt und erprobt werden.
Von der Teilnahme am Projekt erwarten wir Unterstützung dabei, Konflikte zwischen konkurrierenden Nutzungen zu lösen und neue Wege im Umgang mit Regenwasser, Versickerung und Bewässerung zu erproben. Wichtig ist uns auch, Impulse für eine Neuordnung des Tiefbaus und damit verbunden für eine klimaorientierte Gestaltung des öffentlichen Raums zu erhalten. Darüber hinaus wünschen wir uns Hilfestellung bei der Priorisierung von Entscheidungen sowie bei der Entwicklung von Maßnahmen, die sowohl ressourcenschonend als auch synergieorientiert sind. Das Coaching soll uns helfen, den begonnenen Prozess mit dem Stadtwasserhitzeplan Göttingen zu verstetigen, durch Pilotmaßnahmen zu konkretisieren und so langfristig Strukturen für eine klimaresiliente und lebenswerte Stadtgestaltung zu schaffen.
Ansprechpartner*in
Karina Schell, nachhaltigkeit@goettingen.de, 0551 400 3904

Gütersloh ist als kreisgrößte Kommune ein urbanes Zentrum in der Region. Die kompakte Innenstadt ist als Versorgungsstandort von übergeordneter Relevanz. Bis ins Umland hinein wird Gütersloh durch zahlreiche Grünflächen und Gewässer ebenso gekennzeichnet wie durch ländlich geprägte Ortsteile. Die Vielfalt der räumlichen Strukturen geht mit den unterschiedlichsten Ausprägungen der Betroffenheit von den Auswirkungen des Klimawandels einher.
Die Teilnahme am BlueGreen City Coaching ist für Gütersloh aus vielen Gründen reizvoll. So besteht ein hoher Selbstanspruch an die Realisierung bereits vorhandener Planungen zur Umsetzung naturbasierter Lösungen. Der Bedarf ist seit Langem auf allen Ebenen erkannt und anerkannt. Gleichzeitig gehen damit im Detail auch konkrete Herausforderungen in der tagtäglichen Umsetzung einher. Diese begründen sich neben erhöhten Anforderungen an die fachstellenübergreifende Zusammenarbeit insbesondere auf die innerhalb des großen Spektrum an Akteuren naturgemäß hohe Anzahl von zusätzlich zu berücksichtigenden planerischen Vorgaben sowie anderweitigen fachlichen Interessen.
Herausfordernd ist es neben dem Überflutungsschutz auch die Aspekte der Gewässerökologie mitzudenken und der zunehmend hohen Vulnerabilität gegenüber extremen Wetterereignissen vorzubeugen. Ein Gewässerausbau aus hydraulischen Gründen des Hoch-wasserschutzes sollte stets mit Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern zur Verbesserung der Gewässerökologie kombiniert werden. Ebenfalls ist die Grundwasserspeicherung in trockenen Perioden zu optimieren. Das Flächenangebot in der Stadt ist begrenzt, sowie voraussichtlich auch die künftig zur Pflege dieser Flächen bereitstehenden finanziellen Ressourcen.
Die Stadt Gütersloh erhofft sich durch die Teilnahme am Coaching eine optimierte Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Grünflächen und dem Fachbereich Tiefbau, an der Schnittstelle zwischen Überflutungsschutz und Gewässerunterhaltung. Die Mithilfe und Unterstützung bei der Umsetzung bereits vorliegender Konzepte sowie bei der Einbindung der Öffentlichkeit sind von hohem Interesse. Vorhandene Netzwerke und Strukturen innerhalb der Verwaltung sollen gestärkt werden. Zur Erreichung der gesetzten Ziele ist eine intensive multidisziplinäre Arbeitsweise innerhalb der Verwaltung und zwischen der Verwaltung und den Aufsichtsbehörden wichtig. An dieser Stelle sollte das Coaching ansetzen und die Kommune unterstützen. Dabei ist uns wichtig alle Aspekte naturbasierter Lösungen (Schwammstadt, Hochwasserschutz, Stadtklima, Biodiversität) in den Blick zu nehmen und gemeinschaftlich zu betrachten.
Ansprechpartner*in
Nadine Frey Dipl.-Ing.
Stadt Gütersloh
Fachbereich Tiefbau
Abteilung Stadtentwässerung / Team Überflutungsschutz

Die Stadt Herne ist mit ca. 162.00 Einwohner zentral im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen gelegen. Aufgrund ihrer Lage und ihrer Historie als Bergbaustadt und Montanstandort besitzt Herne eine hohe Siedlungs- und Bebauungsdichte. Innerstädtische Siedlungskerne weisen eine Prägung durch das 19. Jahrhundert auf. Charakteristisch ist eine enge Verzahnung von Grünflächen aber auch Altindustrie- und Gewerbestandorten mit Wohnbereichen. Die Stadt Herne ist von den Folgen des Klimawandels durch ihre zentrale Lage im Verdichtungsraum Ruhrgebiet und die hohe städtebauliche Dichte stark betroffen und wird dies auch in Zukunft noch stärker sein. Daher setzt sich die Stadt bereits intensiv mit einer zukunftsorientierten, klimawandelgerechten Stadtentwicklung zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität unter der Voraussetzung notwendiger räumlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen auseinander.
Teil des immer noch andauernden Strukturwandels ist die Umwidmung, Reaktivierung und Sanierung von Gewerbe- und Industriebrachen. Hierbei werden sowohl hochwertige Forschungs-, Dienstleistung-, Wohn- und Gewerbequartiere als auch multifunktionale Freiräume und Quartierparks, die Biodiversität, blau-grüne Strukturen als auch hochwertige Erholungsräume für Menschen entwickelt.
Herne erwartet vom BlueGreen City Coaching Hilfestellung bei der weiteren Etablierung aber auch der Prüfung und Evaluierung der Effektivität von Klimafolgenanpasssungsmaßnahmen. Ebenso hofft die Stadt auf Unterstützung dabei, den Mehrwert solcher Maßnahmen besser in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. In Herne stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Projekte und Maßnahmen zum Ausbau von blau-grüne Strukturen im Rahmen von großen Stadtentwicklungs- und Förderprojekten an.
Ansprechpartner*in
Stadt Herne
Kerstin Agatz
Teamleitung
FB Umwelt und Stadtplanung
kerstin.agatz@herne.de

Magdeburg strebt eine zukunftsorientierte, klimaresiliente Stadtentwicklung an. Die Stadt sieht im Blue Green City Coaching die Chance, bestehende Potenziale besser zu nutzen und strukturelle Hemmnisse – etwa institutionelle Barrieren oder fehlende Ressourcen – zu überwinden. Ziel ist es, nature-based solutions wie das Schwammstadt-Prinzip stärker in die Planungspraxis zu integrieren und Maßnahmen zur Hitzevorsorge, Regenwassermanagement und Biodiversitätsförderung effektiver umzusetzen. Darüber hinaus verspricht sich Magdeburg Impulse zur besseren institutionellen Verankerung grüner Infrastruktur sowie den Austausch mit anderen Kommunen.
Magdeburg steht vor vielfältigen Herausforderungen in der Stadtentwicklung:
Ein hohes Maß an Flächenversiegelung und eine bisher autozentrierte Struktur erschweren die klimatische Resilienz. In zentralen Lagen besteht erheblicher Nutzungsdruck, wodurch Entsiegelung und grüne Maßnahmen schwer umsetzbar sind.
Die lineare Ausdehnung entlang der Elbe führt zu fragmentierten Grünstrukturen und behindert ökologische Korridore. Zusätzlich führen wiederkehrende Dürren und Hitzeperioden zu Wasserstress an Fließgewässern wie Elbe, Schrote und Sülze sowie Hitzestress in bestehenden Grünstrukturen.
Trotz der hohen Dichte an Forschungsinstitutionen ist die Übertragung innovativer Konzepte in die kommunale Planung und Praxis oft durch institutionelle Barrieren oder mangelnde Ressourcen gehemmt. Zusätzlich erschwert eine hohe Fluktuation in der Bürgerschaft – insbesondere durch die Studierendenschaft – stabile Beteiligungsprozesse und den Aufbau nachhaltiger lokaler Netzwerke.
Magdeburg erwartet praxisnahe Strategien zur Umsetzung grüner Infrastruktur, fachliche Beratung zur Fördermittelakquise und Unterstützung bei Nutzungskonflikten im Kontext von Nachverdichtung und Freiraumerhalt. Auch der interkommunale Austausch, die stärkere Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit stehen im Fokus.
Ansprechpartner*in
Laura Hinze
Landeshauptstadt Magdeburg
Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung, Stabsstelle Klima
E-Mail: Laura.Hinze@stadt.magdeburg.de
Die Landeshauptstadt Mainz passt sich an die Folgen des Klimawandels an. Mit unterschiedlichsten Akteuren aus Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften, Politik und der interessierten Öffentlichkeit wurden hierzu Konzepte wie die Klimaanpassungsstrategie oder das Starkregenvorsorgekonzept erarbeitet, welche beschlossen und nun sukzessive umgesetzt werden. Wie häufig bei transformatorischen Prozessen, so stellen sich auch bei der Anpassung an den Klimawandel komplexe Herausforderungen, die nur mit interdisziplinärer Zusammenarbeit gelöst werden können.
Das BlueGreen City Coaching gab dafür einen interessanten Rahmen, die Expertise und den Handlungswillen vor Ort mit externer Kompetenz zusammenzubringen, um umsetzungsorientierte Lösungen zu finden.
Die Herausforderungen sind vielschichtig. Zum einen ist die Landeshauptstadt durch ihre topografische Lage besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Zum anderen erfordern neue Herausforderungen neue Wege der Zusammenarbeit. Daneben existieren strukturelle Herausforderungen wie eine angespannte Haushaltslage und Personalmangel.
Die Grundlage für die Lösung von komplexen Herausforderungen ist die Integration von (wissenschaftlichen) Erkenntnissen ins (kommunale) Handeln. Wir wünschen uns eine umsetzungsnahe Unterstützung durch wissenschaftliche Erkenntnisse und kreative Lösungsansätze der Projektpartner.
Ansprechpartner*in
Paul Grünebach
Abteilungsleiter Klimaschutz und Klimaanpassung

Die Stadt Regensburg blickt auf eine fast 2000-jährige Geschichte zurück und befindet sich seither in einem kontinuierlichen Wandel. Bis 1900 fast unverändert, fand die größte Entwicklung der Siedlungsfläche in der seit drei Jahrzehnten anhaltenden Wachstumsphase statt. Bei dem großen Thema Klimawandelanpassung stehen besonders historisch geprägte Städte häufig vor Herausforderungen. Regensburg ist hier keine Ausnahme: Die hohe Flächenversiegelung und der geringe Anteil an Grünflächen erhöhen die Anfälligkeit der Stadt für extreme Wetterereignisse wie Hitze oder Starkregen. Gerade in Regensburg steht der Begriff der „steinernen Stadt“ immer wieder im Fokus. Die direkte Lage an Donau, Naab und Regen verstärkt zudem die Problematik von Hochwasserereignissen. Als UNESCO-Welterbe und Denkmalschutzensemble gestalten sich Umbauten in der historischen Altstadt besonders komplex. Auch abseits der Innenstadt gibt es nur begrenzte Flächenpotenziale für eine weitere Siedlungsentwicklung, da vorhandene Konversionsflächen nahezu aufgebraucht sind. Die stetig wachsende Einwohnerzahl erfordert daher eine Nachverdichtung, wodurch der Verlust von klimawirksamen Grünstrukturen droht und sich die Flächenkonkurrenz weiter erhöht.
Angesichts dieser Herausforderungen hat sich die Stadt Regensburg aktiv für das Blue Green City Coaching des Umweltbundesamtes beworben. Ziel ist es, durch fundierte Fachberatung und enge Zusammenarbeit mit Experten die betreffenden Fachämter und Personen in einen konstruktiven Austausch zu bringen sowie die stadtinternen Prozesse und Strukturen zu analysieren und zu optimieren. Durch fachlichen Input zu laufenden Vorhaben sollen Lücken identifiziert und Wege gefunden werden diese zu schließen, damit blaugrüne Maßnahmen effizienter umgesetzt werden können und so eine nachhaltige Entwicklung der Stadt vorangetrieben wird.

